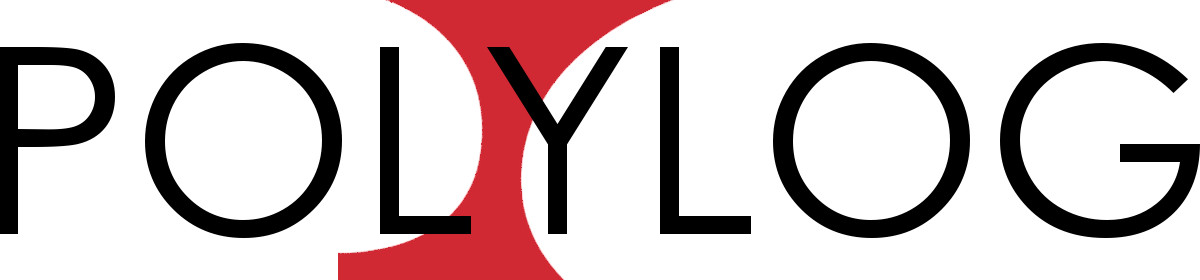Von Larissa Cybenko (Lviv / Lemberg, Ukraine)
Walter Benjamin hat seinen Begriff der Aura unter anderem am Beispiel der Berglandschaft erläutert: Aura „definieren wir als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. An einem Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den Ruhenden wirft – das heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen.“(1) Der Gebirgszug konstituiert sich hier als ästhetisch angeschaute Landschaft. Im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit sind – laut Benjamin – die Aura und so auch die Landschaftsbegriffe dem Verfall unterworfen. Unter den Gründen diesen Verfalls erwähnt der Philosoph folgende: „Er beruht auf zwei Umständen, die beide mit der zunehmenden Bedeutung der Massen im heutigen Leben zusammenhängen: nämlich die Dinge räumlich und menschlich näher zu bringen“ und die „Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion.“(2) Diese These läßt sich am Beispiel einer konkreten Berglandschaft zu verfolgen, und zwar der ukrainischen Karpaten, die Ostkarpaten genannt und für diesen Beitrag von drei Plattformen angeschaut werden.
Vorerst sollte man sich an diese Berge als an eine geographische Landschaft, als an einen „Abschnitt der Erdoberfläche samt dem darüber befindlichen Abschnitt des Himmels“ (so Hellpach)(3) annähern. Die ukrainischen Karpaten liegen im Westen des Landes; wo heute die staatlichen Grenzen von der Ukraine, der Slowakei, Ungarns und Rumäniens zusammenkommen. Sie sind ein gewaltiger Gebirgszug, der sich über 280 Kilometer von Nordwesten nach Südosten mit durchschnittlich 100 Kilometern Breite hinzieht und im Süden in die rumänischen Karpaten übergeht. Bei der Ortschaft Rachiv,(4) an der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien, wurde 1887 von den k.u.k. Erdbeschreiber das geographische Zentrum Europas festgelegt. Die Anschrift am steinernen Obelisk, der an diesem „ewigen Ort“ steht, lautet: „LOCUS PERENNIS / diligentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura gradum meridionalium et parallelorum centrum europeum.“
Als eine Naturlandschaft gehören die ukrainischen Karpaten zu den größten Waldgebirgen der Ukraine und Mitteleuropas und bilden mit ihren drei Pässen den östlichen Teil des Karpatenbogens. In Hinsicht auf die Geologie sind es alte Berge überwiegend mittlerer Höhe, auf deren gewölbten Spitzen der Schnee sich nur bis Ende Mai aufhält. Der höchste Berg der Ostkarpaten – Hoverla – beträgt 2061m; hier kann man manchmal die Schneeüberreste bis Mitte August sehen. Die Karpaten haben einen Mittelgebirgscharakter: die sanft konturierten Hügel sind meistens mit üppigen Wäldern bedeckt, wobei Tannenwälder an den nördlichen und gemischte Laubwälder, darunter nicht selten Buchenwälder, auf den südlichen Hängen wachsen. Das Klima dieser Gegend ist mäßig warm und feucht: im Winter sind die Kämme mit tiefem Schnee bedeckt, im Sommer regnet es oft. Die Ostkarpaten sind reich an Wasserquellen; hier entspringen mehrere Flüsse (Stryj, Dnister, Prut, Tscheremosch, Tyssa u.a.). Besonders malerisch sind diese Berge im Frühherbst, wenn das Laub sich mit allen Tönen von Rot und Gelb verfärbt, wobei die Tannen dunkelgrün emporragen.
Die Besonderheiten der geographischen Lage und die Natur haben die ukrainischen Karpaten zu einer kulturhistorischen Landschaft werden lassen. Schon im Altertum kreuzten sich in dieser Region die Handelswege, die den Westen mit dem Osten verbanden, wodurch eine Mischung der Kulturen entstand. Die Berge waren dabei die natürliche Sperre, die östliche Ausläufer, die Europa vor dem Zug der Nomadenvölker aus Asien schützten. Beispielhaft ist die Rolle der Karpaten während des Widerstandes gegen die Invasion der Tataromongolen im Mittelalter zu nennen. Trotzdem geriet die autochthone slawische Bevölkerung – die Ruthenen(5) – schon ziemlich bald unter die Herrschaft verschiedener Mächte: darunter von Ungarn, Polen, Rumänien, ab Ende des 18. Jh. der Habsburgermonarchie. Zu dieser Zeit entstanden hier drei kulturhistorische Landschaften: Galizien, Bukowina (zisleithanischer Raum) und Transkarpatien (transleithanischer Raum). Die ganze Region umfaßte neben den Ostkarpaten selbst das Karpaten-Vorland und das südliche an Ungarn grenzende ebene Gebiet – Transkarpaten. Entwicklungsgeschichtlich gesehen haben sie eine Einheit gebildet. Die Lage an der Kreuzung der Kulturen (der westlichen-lateinischen Tradition und der östlichen-byzantinischen) verlieh dieser Region eine einmalige Atmosphäre. In diesem Zusammenhang könnte man direkt in den Bergen mehrere Beispiele der alten, fast unberührt gebliebenen Beispiele der Kultur der autochthonen Bevölkerung, die aus mehreren, mitunter stark differenzierten Volksstämmen bestand, treffen. Sie sprachen auch verschiedene Mundarten des Ukrainischen, die infolge der relativen Isolierung voneinander entstanden. Diese Differenzierung wurde dadurch verursacht, daß die Berglandschaft der Ostkarpaten schon immer stark zerklüftet und schwer zugänglich war. Bis heute gibt es hier nur vier bedeutende Straßen und drei Bahnlinien, die noch zu k.u.k. Zeiten angelegt wurden.
Die beiden letzten Momente, und zwar periphere Lage an der Kreuzung verschiedener Kulturen und relative Unzugänglichkeit bewirkten die Herausbildung des eigenartigen Phänomens der Berglandschaft der Ostkarpaten im ästhetisch-philosophischen Sinne, das faszinierend wirkte. Besonders deutlich trat es in den symbolische Formen – wie z.B. in der Literatur – zutage. Sowohl solche „pragmatischen“ Gattungen wie Reiseliteratur und ethnographische Darstellungen aller Art als auch die schöngeistigen Werke, die eine fiktive Wirklichkeit darstellten, konnten dieser Faszination nicht entbehren. Dabei wurde das Karpaten-Phänomen durch die Einmaligkeit dieser Berge geprägt und wirkte meistens von der Ferne, wodurch bestimmte Idealisierungen nicht zu vermieden waren.
Als „grüne Naturinsel“, die der westeuropäischen Zivilisation gegenübergestellt wird, lockten die Ostkarpaten die Aufmerksamkeit der Reisenden schon in der Zeit des „aufgeklärten Absolutismus“. Ein prägnantes Beispiel dazu wäre die vierbändige Reisebeschreibung des österreichischen Gelehrten französischer Herkunft und Professors der Lemberger Universität, Balthasar Hacquet, „Neuste physikalisch-politische Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen Karpathen“ (1790-1796)(6), die mehrere landeskundige Beiträge enthalten. Obwohl Hacquet’s Interesse hauptsächlich der Geographie, Geologie und Biologie der Region gilt, kann er seine Begeisterung für die Sitten und Bräuche der Bergbewohner nicht verheimlichen. Das konnte aber seine Überzeugung an der Notwendigkeit der deutsch-österreichischen Kulturmission (besonders im Schul-, Gesundheits-, Militär- und Gerichtswesen) nicht ändern. Als einer der ersten wendet sich Hacquet der Darstellung eines der eigentümlichsten Stämmen der die Ostkarpaten bewohnten Völker zu – und zwar der Huzulen. Auf ihr besonderes Aussehen, die hochentwickelte und originelle angewandte Kunst, die auch ein Teil des Alltags war und sich bestens in den Trachten darstellte, ihre naturnahe Lebensweise und ihren freiheitsliebenden Charakter haben später viele Ethnographen und Literaten ihr Augenmerk gerichtet.(7) Sie fanden ihren dichterischen Niederschlag in der mehrsprachigen Literatur über die Ostkarpaten.(8)
Obwohl (oder gerade weil) die von österreichischen Aufklärern vorgeschlagenen Zivilisierungsmaßnahmen in den östlichen Provinzen im Laufe des nächsten Jahrhunderts mühsam und meistens nur in den großen Städten (Lemberg, Czernowitz, Stanislawiw) durchgesetzt wurden und die Berge nicht berührten, blieben die Ostkarpaten ein reizendes Reiseziel, das öfters poetisiert wurde. Ein Reiseführer durch die Bukowina aus viel späterer Zeit – Anfang des 20. Jahrhunderts – beschreibt die Karpaten in diesem Kronland verlockend:
„Den ganzen Südwesten des Landes bedeckt das Gebirge, das nahezu unvermittelt aus dem Hügelland emporsteigt; es küßt hier die Steppe den Karpathenbogen und darin liegt der eigentümliche Reiz dieses Gebietes. Mächtige, parallel gefaltete, mit Nadelholz dicht bewaldete Ketten, die in einer Breite bis zu 56 Kilometer reichen, manifestieren sich uns als die Vorlagen des Hochgebirges.“(9)
Daß solche Darstellungen der Berglandschaft nicht an Aktualität verloren, davon zeugt die schnell vergriffene Neuausgabe des Reiseführers. Auch heute bleiben die ukrainischen Karpaten für die Reisenden eine interessante, aber auch mühsame, von der Infrastruktur der modernen Touristik geschonte Entdeckungsgegend.
Viel Aufmerksamkeit wurde den Karpaten schon im 19. Jahrhundert von Seiten der Völkerkunde geschenkt. Davon zeugen die markanten Stellen im „Kronprinzenwerk des Erzherzogs Rudolf“, wo die Berge der östlichen Provinzen der Monarchie „in Wort und Bild“ erscheinen. Als besonders sehenswert wird der Urwald in den Karpaten beschrieben, der die Impression einer unberührten Natur vermittelt:
„In den östlichen, beinahe ausschließlich mit Wäldern und Forsten bedeckten Karpaten, tief im Gebirge […] findet man noch echte Urwälder, welche ihre Unzugänglichkeit und besonders das Fehlen geeigneter wilder Floßwässer vor den Angriffen des Menschen schützte und bis auf unsere Tage bewahrte. Durch Wälder, die schon mehr oder weniger forstmäßig genutzt wurden, gelang man allmählich in eine Wildnis, die wirklich ergreifend ist. Den Boden, auf dem uralte geborstene Stämme lang hingestreckt oder oft haushoch übereinander getürmt morschen, bildet vorwiegend eine tiefe, halbzersetzte, mit dicken Moospolstern belegte Humusschicht, aus der häufig größere Steinblöcke oder Felsen hervorragen, unter denen nicht selten eine Quelle hervorrieselt, deren Wasser nach kurzem Lauf im Gerölle und in moorigen, mit Straußfarn und sprossendem Bärlapp dicht bewachsenen Schichten verschwindet, um weiter desto reichlicher hervorzubrechen.“(10)
Diese reizvolle Gebirgslandschaft, die von der Aura des Natürlichen, Echten und Geheimnisvollen umgeben war, zog vor allem die Künstler an. Das Phänomen der Karpatenlandschaft kam in die schöngeistige Literatur in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Werken der deutschsprachigen österreichischen Schriftsteller aus Galizien und der Bukowina – Leopold von Sacher-Masoch (1836 – 1895) und Karl Emil Franzos (1848-1904).
Der in Lemberg geborene Leopold von Sacher-Masoch, der seine Heimat in früher Jugend verließ, kam immer wieder in die Karpaten. Ihre Landschaft wurde zum besten Hintergrund und zur Dekoration für viele seiner Werke, zu einem der Topoi der für ihn typischen Gegenüberstellung von Osten und Westen. Die Karpaten sind bei diesem oft umstrittenen Schriftsteller eine „grüne Stelle“, die jungfräulich, echt und für ihre Zeit „natürlich“ wirkt. Hier platziert er seine sehnsüchtige Naturwelt, die nicht so reguliert ist, wie die zivilisierten westlichen Welten, die ihre eigene unberührte Aura ausstrahlt. Diese kulturelle Dichotomie wird bei Sacher-Masoch am Beispiel der Gegenüberstellung der Karpaten- und Alpenlandschaft gezeigt:
„Während in den Alpen bei aller Massenhaftigkeit und Schroffheit ihrer Gebirgsstöcke auf allen Berghäuptern, in allen Tälern derselbe gleichmäßige Glanz der Heiterkeit ruht, zeigen unsere Karpaten wie unser Volk eine tiefe, schweigende, unaussprechliche Schwermut, eine gewisse Wildheit, eine vorweltliche, ureigentümliche, unentweihte Großartigkeit, deren düstere Majestät uns nur zu demütigen und niederzudrücken scheint, um uns dann um so mehr über den schweren schwülen Dunst der Erde emporzuheben.
Feierlich thront die jungfräuliche Natur in dem Urwald, der uns drohend umschließt. Uralte Buchen, Rieseneichen schließen ihre breiten Äste, ihr dichtes Blattwerk zu einer gigantischen Kuppel zusammen, welche von oben durch die Sonne beschienen, gleich jenen der Paläste arabischer Märchen, aus einem einzigen Edelstein, einem grünen leuchtenden Smaragd zu bestehen scheint, von einem tiefen geheimnisvollen Rauschen wie von Orgelton durchzittert.“(11)
In der Gegend der Karpaten spielt die Handlung der Erzählung „Don Juan von Kolomea“, die dem unter westlichem Lesepublikum debütierenden Autor einen raschen Erfolg brachte. Laut Ferdinand Kürnberger verkörperte diese Gegend bei Sacher-Masoch die „Poesie der Sinne“, die der „Poesie der Ideen“ der klassischen deutschen Dichtung gegenübergestellt werde.(12) In einem romantischen Luftkurort in den Karpaten nimmt die skurrile Geschichte von „Venus im Pelz“ ihren Anfang. Als „Naturdichter“ hatte Sacher-Masoch im Westen einen großen Erfolg: die Zivilisation erzeugt immer das Verlangen nach dem Exotismus, nach der Perspektive des Entdeckens.
Etwas andere Akzente bezüglich der Karpatenlandschaft findet man bei K.E. Franzos. Mit seinen „Kulturbildern aus Galizien, der Bukowina, Südrußland und Rumänien“ (1870ff), der Feuilletonreihe „Aus Halb-Asien“ (1876), mehreren Reisenotizen und Prosawerken (Erzählungen und dem Roman „Ein Kampf ums Recht“, 1882) „entdeckt“ er diese Gegend dem deutschsprachigen Leser, wobei die Ostkarpaten bei ihm zur natürlichen Grenze zwischen Europa und Asien, zum „Ende der zivilisierten Welt“ werden. Der vom Schriftsteller selbst erfundener Begriff „Halb-Asien“ (eine Definition der Gebiete im Vorkarpatenland) steht am Anfang einer langfristigen literarischen Tradition: er hat mehrere Klischees des „Asiatischen“ hinsichtlich dieses Raumes produziert, deren Resonanz man im Schaffen sogar der modernen Autoren findet, wie z.B. im Gedicht von Ingeborg Bachmann (1926-1973) „Große Landschaft vor Wien“. Außer dem Motiv der Grenze erscheinen die Ostkarpaten bei K.E. Franzos aber auch romantisch und unzivilisiert, sie wirken als Symbol der Unzähmbarkeit, der Kühnheit und der Freiheit.
Ähnliche ästhetische Zugänge zur Darstellung der Ostkarpaten als einer Poesielandschaft, die öfters mythenträchtig ist, findet man in der Tradition der ukrainischen Literatur ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Landschaft wird zum Hintergrund der dramatisch gespannten Handlungen, der Kollisionen der starken Charaktere. Meistens sind das die Autoren aus Galizien und der Bukowina, aber auch die Schriftsteller, die aus den zentralen ukrainischen Gebieten in die Karpatengegend kamen und von diesen Bergen inspiriert wurden; nicht selten wenden sie sich auch zur Gestaltung der Huzulen zu. Hier werden nur einige prägnante Beispiele angeführt.
Besonders beliebt war das Karpatenmotiv bei der hervorragenden ukrainischen Schriftstellerin der Jahrhundertwende aus der Bukowina, Ol’ha Kobyljans’ka (1863 – 1942). „Die Waldmutter. Eine Skizze aus dem ukrainischen Leben“ nennt sie ihre in deutscher Sprache geschriebene Erzählung, deren Hauptgeschehen sich in den Karpaten abspielt: die Tragödie einer alten Huzulin, die ihren einzigen Sohn bei der Rekrutierung durch die k.u.k. Armee am Anfang des Ersten Weltkrieges verliert. Die von der Autorin als Exposition der Geschichte beschriebene gebirgige Wildnis enthält – einem ersten Sonatensatz gleich – die Aufstellung der Stimmung der zu verarbeitenden Themen: Harmonie des mit der Natur eine Einheit bildenden Lebens in den Gebirgen und die Vorahnung der Katastrophe:
Wer kennt das Karpatengebirge?
Auch das im Kronland Bukowina?
Viele, aber vielleicht auch wenige.
Da gibt es Partien, verborgene Schluchten, da gibt es Plätze, wo sich die Götter und Nymphen aufhalten, wo zaubernde Farrenkräuter den Erdenkindern die Augen verhüllen, auf daß sie das übersehen, was für ihre Alltagsseelen unfaßbar wäre und das Auge blenden würde. Die zaubernden Farrenkräuter und Sagenkinder des Karpathengebirges. Wo die heilkräftige und gleichzeitig gifttragende Arnica ungehindert wuchert, ihre Augen über den übermütigen, zuzeiten verschlafenen Bach schweifen läßt und ihren eigentümlichen Duft ausströmt. Wo alles e i n Atem, e i n Rhythmus ist. Waldrauschen, Biegen und Wiegen im Winde, süßes Träumen und Sichgehenlassen, Trägheit in Sonnenglut und Ächzen und Brausen in Gewitterstürmen.
Viele, aber vielleicht auch sehr wenige.(13)
Mychajlo Kozjubuns’kyj (1864 – 1913), ein aus Podolien stammender ukrainischer Impressionist, läßt seine Romeo und Julia-Geschichte bei den Huzulen „Die Schatten vergessener Ahnen“ in der Karpatenwelt spielen. Der nach dieser Novelle von S. Paradzanov gedrehte Film (im Westen unter dem Titel „Die Feuerpferde“ bekannt) war ein großer Erfolg der ukrainischen Kinokunst Anfang der 60er Jahre, unter dessen Einfluß sich die „Schule der Maler“ mit der Kamera herausbildete. „Sinnenfreude und Agonie in einem Rausch von Farben und Tönen“, schrieb über ihn die Kinokritik. Die malerische, aber auch wilde Welt der Karpatengebirge bei Kozjubuns’kyj sprudelt über von alten Legenden, Sagen und Mythen, die er meisterhaft in das Geschehen einflechtet. Sie wirken echt und gestalten die suggestive Atmosphäre dieser Novelle.
Faszinierend wirkt die Karpatenlandschaft im Schaffen eines anderen ukrainischen Autors aus dem Osten der Ukraine Hnat Chotkevyè (1877 – 1938), der nach seiner ersten Bekanntschaft mit diesen Bergen von ihnen nie mehr losgelassen wurde. Gefesselt von der Lebensweise und Folklore der Bergbewohner, gründet er ein Huzulentheater, mit dem er bis nach Wien kommt. Im Zentrum seines Schaffens stehen die Geschichten der Opryski, der Teilnehmer an den rebellischen Aufständen und Karpatenräuber zugleich, besonders ihres Anführers Olexa Dowbus, dem er den gleichnamigen Roman widmet. Realistische Darstellung der Opryski – Bewegung schildert er auch in seinem besten Roman „Räubersommer“ („Die steinerne Seele“ im Original). Nostalgisch beschreibt hier der Autor Sitten, Bräuche und Legenden der Huzulen, mit der Vorahnung, daß mit der kommenden Technisierung die einmalige Aura dieser Welt verschwinden wird:
„und die Welt wird bestehen, solange die Menschen Ostereier malen und zum Jurijfest Feuer abbrennen. Irgendwo hinter hohen Bergweiden und rauschenden Quellen, ganz ferne, so fern, daß wir es uns nicht ausdenken können, sitzt an einem finsteren Quellort, in einer abgrundtiefen Schlucht der älteste Teufel, Pekun genannt. Er wird mit zwölf Ketten an einen Felsen geschmiedet und müht sich Tag und Nacht ab, sich loszureißen. […] Wenn aber die Menschen einmal aufhören werden, Ostereier zu malen und zum Jurijfest abzubrennen, wird diese unsere Welt vergehen, und keine Erinnerung wird an sie bleiben!
Die Volksseele ahnte bereits, daß eine Zeit kommen wird, da man keine Ostereier mehr bemalt: im Marktflecken Kossiw wird man sie herstellen. Es wird auch keine mehr nach ihnen und dem Brauch, der sie hervorrief, fragen. Die Überlieferungen und der Volksglaube werden verschwinden, wie auch die Huzulen mit ihrer Tracht, ihren Sitten und ihrer Kultur der vergangenen Jahrhunderte. ,Diese Welt wird vergehen, und Pekun wird seine Fesseln ablegen!'“(14)
Die Vorahnung des Verfalls der dichterischen Welt der Karpatenlandschaft und der Zerstörung der Aura dieser Berge begann schon ab Ende des 19. Jh. Wirklichkeit zu werden. Sie kam mit der Tendenz der Zeit zur Nutzung des Waldes:
„Sehenswert ist ein solcher Urwald, aber sein Wert als Nutzwald ist sehr gering und darum schwindet er und muß endlich den bewirtschafteten Forsten weichen“ (ÖUM, 826)(15)
Die ursprünglich mit großen Urwäldern bedeckten Hänge der ehemalig waldreichsten Gebirge Europas wurden zum Opfer der Abholzung. Ihre Überreste haben sich 1898 nur in einigen Teilen der östlichen Karpaten erhalten. Die Entwaldung wurde von den „unbedachten Rodungen und besonders einer übermäßigen Waldnutzung“(16) befördert, sie „steigerte sich rapid, als die erleichterten Verkehrsverhältnisse den Absatz in größere Entfernungen nicht nur auf Wasser-, sondern auch auf Landwegen ermöglichten“ (ÖUM, S. 819).(17) Den raschen Vorgang der Industrialisierung verstärkte die 1894 errichtete moderne Eisenbahnstrecke zwischen Galizien mit Ungarn, die mit einem 1221 Meter langen Tunnel und mit der abgebildeten weitgespannten Eisenbahnsteinbrücke versehen wurde. („Vorher hatte man das Gebirge nur auf einer mit Schlaglöchern übersäten Poststraße erreicht, die durch das weite Pruthtal nach Süden lief und auf dem sogenannten Magyarenweg den Körösmezöpaß das Massiv der Czornohora, des Schwarzen Berges, und die Grenze zwischen Galizien und Ungarn überquerte.“(18)). Obwohl man von dieser „in landschaftlicher und technischer Hinsicht schönsten Gebirgbahnstrecke Galiziens“(19) wunderschöne Ausblicke in die Bergwelt hatte, begann die direkte Aufhebung von Distanz und Einmaligkeit der Karpatenlandschaft. Die immer wüster werdende Gebirge verloren allmählich die Ausstrahlung ihres sich selbst genügenden Mikrokosmos.
Der Verfall der Karpatenlandschaft und die Zerstörung ihrer Aura im technischen Zeitalter haben auch ihren Niederschlag in der damaligen Literatur gefunden. Ivan Franko (1856-1916), einer der größten ukrainischen Dichter und Wissenschafter seiner Zeit, schildert in einer historischen Erzählung „Sturm im Tuchla-Tal“ den Zustand der einst unwegsamen Urwälder in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts:
„In der Gegend von Tuchla ist es heutzutage traurig und unwirtlich. Zwar bespülen noch immer der Stryj und der Opir die kieselumsäumten grünen Ufer, zwar sprießen im Frühling wie vorher Gras und Blumen auf den Wiesen, und der Königadler zieht seine Kreise in der durchsichtigen azurblauen Luft, aber wie hat sich alles übrige verändert, der Wald, die Dörfer und die Menschen! Einst bedeckten dichte, undurchdringliche Wälder fast den ganzen Hang, von den Flüssen im Tal bis zu den Bergweiden; jetzt sind sie wie Schnee in der Sonne zusammengeschmolzen, sind gelichtet, mitunter ganz verschwunden. Große Flecke liegen kahl. Nur hier und da steht eine verkrüppelte Tanne oder ein kümmerlicher Wacholderstrauch zwischen verkohlten Baumstümpfen.
Früher herrschte hier eine tiefe Stille-, kein Laut war zu hören außer der Trembita eines Hirten von einer fernen Bergweite, dem Brüllen eines Auerochsen oder dem Röhren eines Hirsches aus dem Dickicht. Jetzt gellen die Schreie der Hirten über die Weideplätze, in der Waldestiefe und in den Schluchten lärmen Holzfäller, Sägewerker und Zimmerleute, die unausgesetzt die Schönheit der Tuchlaer Berge zerwühlen und benagen wie ein Wurm. In große Stücke zersägt, treiben die jahrhundertealten Tannen und Fichten stromabwärts zu den neuen Damphsägewerken, oder sie werden gleich an Ort und Stelle zu Balken und Brettern zerschnitten.“(20)
Diese Berge ließen sich als ästhetisch angeschaute Landschaft nicht mehr rekonstituieren. Die Distanz zu ihnen und ihre Einmaligkeit sind infolge der „Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion“ und durch den Umstand, die Dinge räumlich und menschlich näher zu bringen“, aufgehoben.(21)
Abschließend sollte noch erwähnt werden, daß die Bestrebungen, eine Berglandschaft „räumlich und menschlich näher zu bringen“(22), ihren Verfall nicht nur im ästhetisch-philosophischen Sinne zufolge haben kann, sondern auch hinsichtlich der Ökologie. Die Folgen der unüberlegten Rodungen in den Ostkarpaten waren bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts bekannt: „Flugsandflächen, schlechtes Weideland, oft auch schlechtes Ackerland“.(23) Heute kommen ihnen mehrere gewaltige Überschwemmungen in der Region der Ostkarpaten, die ruinierend wirken, nach. Das billige Holz aus dieser Berglandschaft wird in Westeuropa gerne angekauft, worauf die „humanitären Hilfen“ in der Form der Gummistiefel folgen.
Anmerkungen
(1) Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. – Frankfurt am Main: Suhrkamp 1963, S. 18.
(2) Ebenda., S. 18.
(3) Hellpach W.: Geopsyche: die Menschenseele unter dem Einfluß von Wetter und Klima, Boden und Landschaft. Stuttgart: Enke,1965, S. 168.
(4) Alle Namen der Orte bzw. der Flüsse und der Berge werden laut ukrainischen Klang wiedergegeben.
(5) Das Ethnonym „Ruthenen“ ist von der entsprechenden Form im Ukrainischen -„russyny“ – abgebildet. Es war vor allem in Österreich-Ungarn verbreitet. Diese Selbstbezeichnung wurde später durch den Namen „Ukrainer“ im Rahmen des ganzen Landes ersetzt.
(6) Hacquet B. Hacquet’s neuste physikalisch-politische Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen Karpathen. Nürnberg: Raspische Buchhandlung,1790, 1791, 1794, 1796.
(7) Den Huzulen wird viel Aufmerksamkeit im „Kronprinzenwerk“ gewidmet, wie. z.B. in der folgenden Brschreibung ihres Aussehens: Ein Huzule „ist gewöhnlich kräftig gebaut, von hoher schlanker Statur und zeichnet sich durch männliche Gesichtszüge, gebräunte Hautfarbe, schwarze Augen und schwarzes langes Haar, schöne Adlernase und langen Schnurrbart aus.“( Österreich-Ungarische Monarchie in Wort und Bild. [Weiter: ÖUM.] Bd. 14. Galizien. Wien 1898, S. 387).
(8) Woldan A. Die Huzulen in der Literatur //Galizien: ethnographische Erkundung bei den Bojken und Huzulen in den Karpaten. Herausgebgeben von Plöckinger V., Beitl M., Göttke-Krogmann U. Wien: Österr. Museum für Volkskunde, 1998., S. 151-166.
(9) Illustrierter Führer durch die Bukowina von Hernann Mittelmann Czernowitz 1907/1908. – Neu herausgegeben von Helmut Kusdat. Wien: Mandelbaum 2001, S. 11.
(10) Kohl I., Brix E. Galizien in Bildern. Die Originalillustrationen für das „Kronprinzenwerk“ aus den Beständen der Fideikommißbibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien: Selbstverlag Verein für Volksschulen -1997,- S. 91.
(11) Sacher-Masoch L. von. Eigentum. Bd. 1. Bern: Georg Froeleen 1877, S. 198-199.
(12) Kürngerger F.: Vorrede zum „Don Juan von Kolomea“, abgedruckt in Sacher-Masochs „Vermächtnis Kains“, 1870. Sacher-Masoch L. von.: Don Juan von Kolomea. Bonn, 1985, S. 189.
(13) Kobyljans’ka O. Die Waldmutter. Eine Skizze aus dem ukrainischen Leben. Simonek S., Woldan A. (Hg.) Europa erlesen. Galizien. Klagenfurt/Celovec: Wieser, 1998, S. 57 – 58.
(14) Cotkevyè H. „Der Räubersommer“ . Gauß K.-M., Pollak M. Das reiche Land der armen Leute. Literarische Wanderungen durch Galizien. Wien: Jugend und Volk 1992, S. 133-134.
(15) Kohl I., Brix E. Op. cit., S. 91.
(16) Ebenda.
(17) Ebenda.
(18) Pollak M. Nach Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. Wien – München: Christian Brandstätter 1984, S. 81.
(19) Kohl I., Brix E. Op. cit., S. 94.
(20) Franko I. Vorwort zu „Sturm im Tuchla-Tal“ . Nach Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen. Eine imaginäre Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina, S. 69.
(21) Benjamin W. Op. cit., S. 18.
(22) Ebenda.
(23) Kohl I., Brix E. Op. cit., S. 91.