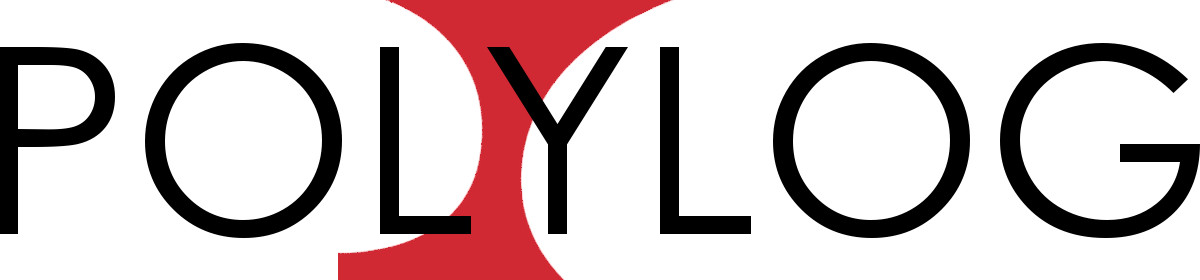Von Anette Horn (Kapstadt)
Berge – im Gegensatz zu den Niederungen und Tälern, die mit der Mittelmäßigkeit des modernen Alltags in der bürgerlichen Gesellschaft assoziiert werden – tragen die Sememe Einsamkeit, Genialität, Überblick und Weitsicht, die allerdings mit großer Mühe einhergeht, die immer auch ein Gefahrenpotential im wortwörtlichen wie im metaphorischen Sinne in sich birgt. Daher scheinen diese schmalen Gratwanderungen mit dem Odium des göttlichen Scheiterns behaftet. Sind sie aber dadurch diskreditiert? Stehen sie nicht eher in einem dialektischen Verhältnis zur Mittelmäßigkeit der Masse, die sie in einem langwierigen Prozeß auf ein höheres Niveau anheben?
Daß Berge jedoch auch eine willkommene Befreiung aus dem unglückseligen Alltag eines Stubengelehrten bedeuten können, reflektiert Nietzsche in der Figur des Anti-Propheten und Bergsteigers, Zarathustra, seinem wohl berühmtesten, aber auch oft mißverstandenen Text: „Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger, sagte er zu seinem Herzen, ich liebe die Ebenen nicht, und es scheint, ich kann nicht lange still sitzen. Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme – ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen: man erlebt endlich nur noch sich selber.“1 Hier kontrastiert Nietzsche die seßhafte Lebensweise des Gelehrten, die sich auf einer Ebene abspielt, mit einer anderen Form des Lebens und Denkens, die mit der körperlichen Anstrengung und Gefahr, aber auch der Beweglichkeit und Sprunghaftigkeit der Berge und des Bergsteigens verbunden ist. Die Berge fordern somit eine körperliche und geistige Aktivität heraus, die mit Eroberung verglichen werden kann.
Dagegen steht die Passivität des sitzenden Stubengelehrten, der sein Wissen aus toten Büchern bezieht. Sein Denken ist reaktiv, denn es reagiert nur auf bereits vorhandenes Wissen, indem er es kommentiert. Gemeint ist damit die Philologie, Nietzsches Brotstudium. Dem setzt er ein aktives, bewegliches Denken entgegen, das neue Erkenntnisse hervorbringt. In einem Aphorismus mit der Überschrift Angesichts eines gelehrten Buches äußert er dazu folgendes: „Wir gehören nicht zu denen, die erst zwischen Büchern, auf den Anstoß von Büchern zu Gedanken kommen – unsre Gewohnheit ist, im Freien zu denken, gehend, springend, steigend, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen oder dicht am Meere, da wo selbst die Wege nachdenklich werden.“2 Aus dieser neuen Daseins- und Denkweise leitet er einen neuen Wertekanon ab, dem folgende Kriterien zugrundeliegen: „Unsre ersten Wertfragen, in bezug auf Buch, Mensch und Musik, lauten: ´kann er gehen? mehr noch, kann er tanzen?´ … Wir lesen selten, wir lesen darum nicht schlechter – oh wie rasch erraten wir’s, wie einer auf seine Gedanken gekommen ist, ob sitzend, vor dem Tintenfaß, mit zusammengedrücktem Bauche, den Kopf über das Papier gebeugt: oh wie rasch sind wir auch mit seinem Buche fertig! Das geklemmte Eingeweide verrät sich, darauf darf man wetten, ebenso wie sich Stubenluft, Stubendecke, Stubenenge verrät.“3 Das bedeutet aber, daß die Physiologie ein Urteil abgeben soll über die Erkenntnis, der Stil über den Inhalt.
Angesichts dieser neuen Daseinsform erscheint der Stubengelehrte in der Rolle des Totengräbers: „Die Totengräber graben sich Krankheiten an. Unter altem Schutte ruhn schlimme Dünste. Man soll den Morast nicht aufrühren. Man soll auf Bergen leben. Mit seligen Nüstern atme ich wieder Berges-Freiheit! Erlöst ist endlich meine Nase vom Geruch alles Menschenwesens! Von scharfen Lüften gekitzelt, wie von schäumenden Weinen, niest meine Seele – niest und jubelt sich zu: Gesundheit!“4 Berge konnotieren hier die Gesundheit nach der Krankheit, die die Beschäftigung mit den Toten (auch dem toten Wissen der Gelehrten) in den Tälern auslöst. Bezeichnenderweise gewinnt nun der Geruchssinn, also der Leib, über den Verstand im menschlichen Zusammenleben die Oberhand. Es ist fast, als würde die Natur den Sinnen des so befreiten Individuums zuprosten. Das Niesen befreit es dann von den letzten Überresten des Bücherstaubes und anderen Krankheitserregern, die in den Städten grassieren.
Dies ist oft als eine anti-moderne Haltung verstanden worden, die sich gegen die Verstädterung im Zuge der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts richtete, und eine Zuflucht in der Natur fand, doch könnte man auch Züge einer asketischen Haltung darin erkennen, die sich durch die Zivilisationsgeschichte zieht vom Gilgamesh-Epos über Christus, der sich in die Wüste züruckzog, bis hin zu den christlichen Mystikern des Mittelalters. Andererseits wertet Nietzsche diese asketische Tradition um im Sinne einer Bejahung solcher anti-asketischer Werte wie der Körperlichkeit und Sinnlichkeit. Die scheinbare Askese des in die Berge Flüchtenden wäre somit nur ein Umweg zu einer Steigerung des Lebens.
Es findet somit eine eindeutige Fluchtbewegung aus einem als unerträglich empfundenen Alltag statt, der vor allem außergewöhnliche Individuen bedürftig zu sein scheinen, doch auch eine deutliche Aufwertung der außergewöhnlichen gegenüber den durchschnittlichen Individuen, die sich deutlich von früheren versöhnlichen Perspektiven abhebt, wie der Jean Pauls. Über Pope schreibt er, daß er, „wie die meisten britischen Dichter aus der zugebornen Lebens-Furche und Wolke zu jener Berghöhe aufsteigt, worauf man Furchen und Wolken überblickt und vergißt“. (SW I, 5, 146) Hiermit wird höchstens ein zeitweiliges Vergessen der alltagsbedingten Schwierigkeiten und Ärgernisse angestrebt, das dann aber wieder in eine geläuterte Akzeptanz der Gesellschaft einmündet. Das hängt wohl mit den verschärften Widersprüchen der Produktionsbedingungen der Intellektuellen in der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft zusammen, da sie die Verwirklichung ihrer Ideale wie etwa noch in der Aufklärung (z.B. eine umfassende Volksbildung) nicht mehr gewährleistet sahen.
Die Intellektuellen sind nun zu Außenseitern geworden, die quer zu ihrer Zeit und dem Zeitgeist stehen, sei es, daß sie weit in die Zukunft vorausschauen, sei es, daß sie in der Vergangenheit steckengeblieben scheinen. Diese Unzeitgemäßheit erscheint auch als Menschenfeindlichkeit, die jedoch eher eine psychohygienische Maßnahme gegen die Wut auf den herrschenden Ungeist darstellt, als den Nietzsche schon seinerzeit den Nationalismus und Rassismus erkannte: „Nein, wir lieben die Menschheit nicht; andererseits sind wir aber auch lange nicht »deutsch« genug, wie heute das Wort »deutsch« gang und gäbe ist, um dem Nationalismus und dem Rassenhaß das Wort zu reden, um an der nationalen Herzenskrätze und Blutvergiftung Freude haben zu können, derenthalben sich jetzt in Europa Volk gegen Volk wie mit Quarantänen abgrenzt, absperrt. Dazu sind wir zu unbefangen, zu boshaft, zu verwöhnt, auch zu gut unterrichtet, zu »gereist«: wir ziehen es bei weitem vor, auf Bergen zu leben, abseits, »unzeitgemäß«, in vergangnen oder kommenden Jahrhunderten, nur damit wir uns die stille Wut ersparen, zu der wir uns verurteilt wüßten als Augenzeugen einer Politik, die den deutschen Geist öde macht, indem sie ihn eitel macht, und kleine Politik außerdem ist – hat sie nicht nötig, damit ihre eigene Schöpfung nicht sofort wieder auseinanderfällt, sie zwischen zwei Todhasse zu pflanzen? muß sie nicht die Verewigung der Kleinstaaterei Europas wollen?…“5 Besser könnten es heutige Politiker und Intellektuelle, die sich zu der Idee und Praxis eines vereinigten Europa bekennen, wohl nicht sagen.
Zweierlei Gründe sprechen für ein geeintes Europa: zum Einen die Durchmischung aller Rassen auf diesem Kontinent, und zum Anderen die gemeinsame geistig-kulturelle Tradition, die — ohne daß sie museal aufbewahrt wird — in der Überwindung, die eine gründliche Durcharbeitung voraussetzt, die modernen Europäer definiert: „Wir Heimatlosen, wir sind der Rasse und Abkunft nach zu vielfach und gemischt, als »moderne Menschen«, und folglich wenig versucht, an jener verlognen Rassen-Selbstbewunderung und Unzucht teilzunehmen, welche sich heute in Deutschland als Zeichen deutscher Gesinnung zur Schau trägt und die bei dem Volke des »historischen Sinns« zwiefach falsch und unanständig anmutet. Wir sind, mit einem Worte – und es soll unser Ehrenwort sein! – gute Europäer, die Erben Europas, die reichen, überhäuften, aber auch überreich verpflichteten Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes: als solche auch dem Christentum entwachsen und abhold, und gerade, weil wir aus ihm gewachsen sind, weil unsre Vorfahren Christen von rücksichtsloser Rechtschaffenheit des Christentums waren, die ihrem Glauben willig Gut und Blut, Stand und Vaterland zum Opfer gebracht haben.“6 Damit macht Nietzsche ganz deutlich, daß er nicht in einen Zustand vor der Moderne und dem Christentum zurückfallen will, sondern daß es ihm um eine Höherentwicklung der höchsten europäischen Werte und Errungenschaften geht, und daß dieses Projekt ebensoviel Tapferkeit erfordert, wie seinerzeit die Durchsetzung des Christentums in Europa.
Angesichts dieser Äußerungen Nietzsches ist es paradox, daß die nationalsozialistische Ideologie sich seiner Philosophie bemächtigte. Das zeigt einmal mehr, daß Philosopheme nie aus ihrem Kontext, zu der auch ihre Genealogie gehört, herausgerissen und einfach zitiert werden können, da in diesem Fall immer der einfache, alltägliche Sinn ihrer Benutzer in sie hineinprojeziert wird. Gegen diese Verunglimpfung seiner Gedanken durch die Nazis war Nietzsche leider auch dadurch nicht gefeit, daß er „dunkel“ schrieb, hatte er sich doch diese Devise zustimmend aus Jean Paul notiert: „Im Ganzen ist es recht, wenn alles Große von vielem Sinn für einen seltnen Sinn nur kurz und (daher) dunkel ausgesprochen wird, damit der kahle Geist es lieber für Unsinn erkläre als in seinen Leersinn übersetze. Denn die gemeinen Geister haben eine häßliche Geschicklichkeit, im tiefsten und reichsten Spruch nichts zu sehen als ihre eigne alltägliche Meinung.“7 Dem stellt er folgenden Aphorismus Jean Pauls zur Seite: „Zu den redenden Künsten gehört die schweigende.“8 Das, was Nietzsche an Jean Paul kritisiert, sein angeblich witzloser gelehrter Stil, der ihn als „Verhängnis im Schlafrock“ erscheinen ließ, hat ihn jedoch auch davor bewahrt, für fragwürdige ideologische Zwecke mißbraucht zu werden, während Nietzsches Vorliebe für Schneid ihm wiederum zum Verhängnis geworden ist.
Dieser Schneid äußert sich z.B. in Nietzsches Vorliebe für das Motiv des Kriegers, wenn er etwa sagt: „Mutig, unbekümmert, spöttisch, gewalttätig – so will uns die Weisheit: sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann.“9 Damit wollte er sicherlich eine müde gewordene Zeit provozieren, doch ist diese Haltung auch als Kriegs- und Gewaltverherrlichung mißverstanden worden. Andererseits birgt die Metapher des Bergsteigens und Wanderns die Gefahr der Vereinsamung und der Selbstüberschätzung des großen Einzelnen, die zum Absturz führen. Nietzsche ist sich dieser Gefahren durchaus bewußt, und nimmt sie ohne Wehleid auf sich. Die Höhe steht in einem dialektischen Verhältnis zu den Tiefen, die er durchmessen muß. Das impliziert, daß die Selbsterhöhung durch Leiden erkämpft ist und Teil eines ständigen Prozesses der Auf- und Abstiegs ist. So heißt es im Zarathustra: „Also sprach Zarathustra im Steigen zu sich, mit harten Sprüchlein sein Herz tröstend: denn er war wund am Herzen wie noch niemals zuvor. Und als er auf die Höhe des Bergrückens kam, siehe, da lag das andere Meer vor ihm ausgebreitet: und er stand still und schwieg lange. Die Nacht aber war kalt in dieser Höhe und klar und hellgestirnt. Ich erkenne mein Los, sagte er endlich mit Trauer. Wohlan! Ich bin bereit. Eben begann meine letzte Einsamkeit. Ach, diese schwarze traurige See unter mir! Ach, diese schwangere nächtliche Verdrossenheit! Ach, Schicksal und See! zu euch muß ich nun hinabsteigen! Vor meinem höchsten Berge stehe ich und vor meiner längsten Wanderung: darum muß ich erst tiefer hinab, als ich jemals stieg: – tiefer hinab in den Schmerz, als ich jemals stieg, bis hinein in seine schwärzeste Flut! So will es mein Schicksal: Wohlan! Ich bin bereit.“10 Die Dialektik von Höhe und Tiefe, Berg und Tal, wird noch einmal durch den geologischen Vergleich angesprochen: „Woher kommen die höchsten Berge? so fragte ich einst. Da lernte ich, daß sie aus dem Meere kommen. Dies Zeugnis ist in ihr Gestein geschrieben und in die Wände ihrer Gipfel.“11
Der Berg ist somit etwas, das eine Perspektive erlaubt, auf ihn oder von ihm. Damit kann aber auch eine Enttäuschung einhergehen, wenn nämlich das, was man für Größe hielt, sich als weniger entpuppt. Daraus leitet Nietzsche ein Absehen von der Selbsterkenntnis ab: „Aus der Ferne. – Dieser Berg macht die ganze Gegend, die er beherrscht, auf alle Weise reizend und bedeutungsvoll: nachdem wir dies uns zum hundertsten Male gesagt haben, sind wir so unvernünftig und so dankbar gegen ihn gestimmt, daß wir glauben, er, der Geber dieses Reizes, müsse selber das Reizvollste der Gegend sein – und so steigen wir auf ihn hinauf und sind enttäuscht. Plötzlich ist er selber, und die ganze Landschaft um uns, unter uns, wie entzaubert; wir hatten vergessen, daß manche Größe, wie manche Güte, nur auf eine gewisse Distanz hin gesehn werden will, und durchaus von unten, nicht von oben – so allein wirkt sie. Vielleicht kennst du Menschen in deiner Nähe, die sich selber nur aus einer gewissen Ferne ansehen dürfen, um sich überhaupt erträglich oder anziehend und kraftgebend zu finden; die Selbsterkenntnis ist ihnen zu widerraten.“12 Allerdings wäre eine begrenzte Selbsterkenntnis die Voraussetzung der Erkenntnis, als Auslöser einer lebenslangen Reise.
Vielleicht ist es daher ein Vorteil, nicht in den Kanon mit seinen präskriptiven Normen und Werten aufgenommen zu werden, sondern eher etwas abseits gelegen, Perspektiven für langsame und genaue Leser zu eröffnen. Statt Bergsteigen also doch wieder die Mühen der Ebenen auf sich nehmen, die sich auf Kamelen oder zu Pferde reitend auf eine andere nomadisierende Weise den heutigen postmodernen Menschen erschließen. Statt Einsamkeit und Pathos des großen Einzelnen auf Bergeshöhen vernetztes Arbeiten in einem Team, in dem die Fähigkeiten jedes/jeder Einzelnen anerkannt werden. Statt der Pyramide als gesellschaftliches Modell ein Netzwerk mit möglichst vielen Knoten. Das bedarf jedoch eines hohen, breiten Bildungsniveaus als Fundament. Dafür lohnt es sich zu arbeiten.
Meine Forschungen zu Jean Paul wurden von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung durch ein Forschungsstipendium gefördert.
Anmerkungen
1 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Werke in drei Bänden. Herausgegeben von Karl Schlechta, München: Hanser, 1954. Bd. 2, S. 403
2 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Bd. 2, S. 239
3 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Bd. 2, S. 239.
4 Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Bd. 2, S. 434-435.
5 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Bd. 2, S. 253.
6 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Bd. 2, S. 253.
7 Friedrich Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, Nachgelassene Schriften, 1870-73, Kritische Studienausgabe. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag/de Gruyter, 1988. = KSA 1.830
8 Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Sommer 1872- Ende 1874, KSA 7.693
9 Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Bd. 2, S. 306.
10 Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Bd. 2, S. 404-405.
11 Nietzsche: Also sprach Zarathustra, S. 404-405.
12 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Bd. 2, S. 48-49.