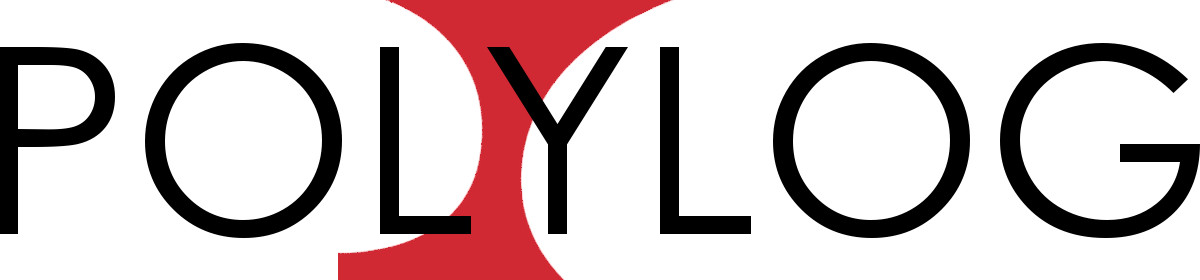Von Alessandra Schininà (Catania)
Das Verhältnis der Sizilianer zu ihren Bergen ist durch ihre Lage als Bewohner einer inmitten des Mittelmeeres liegenden Insel bestimmt. So ist das Binom Berg-Meer für die sozialen, wirtschaftlichen, landschaftlichen und kulturellen Kontexte von einschneidender Bedeutung. Das Territorium Siziliens ist überwiegend gebirgig – außer dem über 3.300 m hohen Ätna an der Ostküste gibt es im Norden die Gebirgsketten der Peloritani, Nebrodi und Madonie, mit Höhenlagen um die 2.000 m, und im Süden die der Iblei und Erei – und doch wird Sizilien in der allgemeinen Vorstellung meist mit Meeres- und Küstenlandschaften verbunden. Selbst die Geschichte der sizilianischen Berge und die um sie kreisenden Mythen und Legenden, zeigen eine enge Verbindung zum Meer. Das geschieht nicht nur aus geographischen Gründen, weil man z.B. von den Berghöhen aus weite, das Meer umfassende Panoramen genießen kann, sondern auch als Folge der konfliktreichen Beziehungen der Sizilianer zu den Gebirgslandschaften im Innenland. Mit Ausnahme des Ätna, der als Vulkan eine Reihe von Besonderheiten aufweist, wurden die übrigen Berge einst stets als Zufluchtsort vor den über das Meer nahenden Invasoren betrachtet – vor Griechen, Römern, Byzantinern, Arabern, Normannen. So waren im Laufe der Jahrhunderte die Bewohner mehrmals gezwungen, das reiche und fruchtbare Land entlang der Küsten zu verlassen, und in die wilden, unwirtlichen Berge des Inneren zu fliehen. Noch heute sind die Küstenstriche Siziliens dichter besiedelt als das Innere der Insel. Abholzung, Unwegsamkeit und Verbreitung des Latifundiums haben die Geschichte der sizilianischen Berge geprägt. Aus der Dialektik Meer-Berge, Mobilität-Isolation, Dürre-Fruchtbarkeit, Mensch-Natur entstand eine vielfältige Vermischung von Kulturen, die den Reiz der sizilianischen Landschaft ausmachen.
In vielen Bergnamen Siziliens findet man noch Spuren der prähistorischen Vergangenheit, sowie der späteren Invasorenwellen. Es gibt oft doppelte Bezeichnungen für denselben Ort. So stammt der Name Ätna aus dem griechischen Aitnh, d. h. brennend, aus dem Verb aiqw, ich brenne, aber der höchste aktive Vulkan Europas wird auch Mongibello genannt, aus dem lateinischen mons und dem arabischen Gebel, jeweils Berg, somit eine pleonastische Benennung. Die Monti Nebrodi entnehmen ihren Namen aus dem Griechischen, aus nebros, d.h. Rehe, Wild, das einst in den Eichen- und Buchenwäldern dieser Bergkette lebte. Die Nebrodi heißen aber zugleich auch Caronie, aus der arabischen Benennung Al Qaruniah. Die Monti Iblei verdanken ihre Bezeichnung der antiken sikulischen Stadt Ibla, ihrerseits nach der heidnische Göttin Hybla benannt. Der höchste Berg dieser Kette ist der fast 1.000 m hohe Monte Lauro, lateinisch Laurus, Loorber. Der Name des Monte Erice, an der Westküste Siziliens, geht auf die griechische Mythologie zurück, auf den Giganten Erux, einen Sohn Poseidons; derselbe Berg und die darauf liegende Stadt hießen aber auch Monte San Giuliano. Im allgemeinen bestehen die Namen von Gipfeln und Bergstädten aus einer Mischung von sikulischen, griechischen, lateinischen, arabischen, normannischen, spanischen Elementen, als Folge der verschiedenen Ansiedlungen.
In der Entwicklung der Beziehungen zwischen Mensch und Berg in Sizilien sind verschiedene Phasen erkennbar. Die erste Phase kann als mythisch bezeichnet werden und ist mit dem Übergang von der Prähistorie zur Geschichte verbunden, als die ersten Bewohner der Insel, die Sikuler und die Sikanen, mit den Griechen in Kontakt kamen und Sizilien Teil der Magna Graecia wurde. Durch die griechische Literatur erscheinen somit die sizilianischen Berge, als erster der Ätna, schon am Anfang der westlichen Kultur und erhalten eine poetisch-metaphorische Bedeutung. So entstand z.B. der Mythos vom göttlichen Hephaistos, der im Krater des Vulkans die Waffen für die Götter mit seinen Gehilfen, den einäugigen Zyklopen, schmiedete und von Polyphem, der riesige Felsbrocken gegen die Schiffe des Odysseus warf, und so die heutigen Faraglioni-Felsen von Acitrezza, einem Fischerdorf an der Küste, geschaffen haben soll. Auch Sterope und Bronte, heute Ortsnamen an den Hängen des Ätna, waren der Legende nach Riesen, die Steine, Felsen und Blitze um sich schleuderten. Eine weitere Legende ist die vom Titan Typhoeus, der von Zeus lebend unter dem Ätna begraben wurde und Feuer und Flammen speit, oder die von Enceladus, der von einem riesigen, von der Göttin Athene geworfenen Felsen zerquetscht wurde, mit seinem Körper Sizilien, mit seinem Haupt den Ätna bildete und mit seinem Blut die Lavaausbrüche verursacht. Hier wanderte auch Demeter/Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit, die auf der Suche nach Persephone/Proserpina, ihrer von Pluto entführten Tochter, hunderte von Fackeln an den Abhängen des Ätna entzündete1.
Solche Legenden sind nicht zufällig mit Feuer, Erdbeben und Fruchtbarkeit verbunden: man versuchte damit erstaunliche, unbegreifliche, vulkanische Naturphänomene zu erklären und die Angst vor dem feuerspeienden Berg zu bannen. Erst im Laufe der griechischen Kolonisation begannen Wissenschafter und Philosophen den Vulkan als Studiensobjekt zu betrachten. Pindar, Aeschylos, später Vergil und Tucidide, beschrieben zwischen Dichtung und Wahrheit den Vulkan und seine Ausbrüche (berühmt ist der von 475 v.Chr.). Ebenfalls zwischen Wissenschaft und Legende bewegt sich die Geschichte des Philosophen Empedokles, der im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte und sich in den Vulkankrater gestürzt haben soll. Für antike und moderne Dichter, von Horaz über Hölderlin bis Brecht, war Empedokles’ Schicksal Anlaß für die verschiedensten ethischen und künstlerischen Betrachtungen über das Verhältnis zwischen Kultur und Natur. Nicht nur der kontrastreiche Ätna regte die Phantasie der antiken Dichter an, auch die Monti Iblei wurden wegen ihres aromatischen Honigs besungen; über die üppige Vegetation der Wälder der Nebrodi schrieb Diodorus Siculus schon vor 2.000 Jahren.
Die Kolonisation Siziliens durch die Griechen und die Phönizier verursachte jeweils die Migration der Ureinwohner in die Berge, ins Landesinnere. Unter der römischen Herrschaft fand auch eines der ersten Beispiele einer verheerenden, verwüstenden Ausbeutung des Naturreichtums statt. Die Römer brauchten Holz für ihre Flotte und Weizen für ihre Städte und fanden in den damals waldreichen Bergen und Hochebenen Siziliens ideale Versorgungsmöglichkeiten. Die Bergzonen erlitten so einen systematischen und brutalen Kahlschlag; tausende Hektar von Wäldern fielen dieser Politik zum Opfer. Die dadurch verursachten hydrologischen und geologischen Schäden reichen bis in unsere Zeit.
Hier soll eine weitere Charakteristik der sizilianischen Berge erwähnt werden. Es fehlt an Erdschätzen oder besser gesagt, diese werden kaum geschürft. Die einzige Bergbauindustrie Siziliens beschränkte sich auf die Schwefelgruben in den zentralgelegenen Hügeln und auf die Asphaltminen in den Monti Iblei. Salz wird aus den Salinen den Küsten entlang gewonnen und erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wird Erdöl in der Gegend der Monti Iblei gewonnen. Die ökonomische Ausnützung der Berge dient noch jetzt hauptsächlich forst- und landwitschaftlichen Zwecken, mit Ausnahme der offenen Steinbrüche für Baumaterial.
Bezeichnend ist eine Legende über die Entstehung des Namens des Monte Soro (1.847 m), des höchsten Gipfels der Monti Nebrodi, angeblich Abkürzung von Monte del Tesoro (Schatzberg). Bei den Schätzen, die ein Hirte der Legende nach im Innern des Berges fand, handelte es sich nicht um Diamanten oder andere Edelsteine, sondern um einen großen Marktplatz, auf dem alle Produkte der Gegend angeboten werden: Kupfergeschirr, Kunstkeramik, Tücher, Linnen und Wolle, Pferde, Schafe und Kühe, Käse, Obst und Gemüse. Der arme Hirte kann sich nur eine Orange kaufen, die sich bei Tageslicht aus purem Gold erweist. Die wahren Schätze des Berges sind also Produkte der Erde und des Handwerks2.
Die geographische Lage Siziliens und der Einfluß des Mittelmeerklimas ermöglichen den Anbau von Nutzpflanzen bis zu relativ hohen Lagen: dort wachsen Weizen, Weinstöcke, Obst- und Olbäume, Haselnußsträucher3 . Die Araber brachten neue Pflanzenkulturen und technische Erfindungen für die Landwirtschaft wie die Wassermühlen, die sich bald im Inneren der Insel verbreiteten. Im Laufe des Mittelalters, unter den Normannen, konsolidierte sich die feudale Struktur des Großgrundbesitzes. Zugleich entstanden in den Berggebieten castelli, rocche und befestigte Städte. Dorthin flüchtete sich die Bevölkerung vor den Überfällen der Sarazenen und bildete unabhängige Gemeinden. Zahlreiche Bergabhänge und Hochebenen wurden als Weide- und/oder Ackerland mittels eines Rotationssystems bewirtschaftet. Es handelte sich meist um Extensivkulturen oder Brachfelder für Viehherden, die die wenig gewinnbringende Wirtschaft der Bergzonen bis ins 21. Jahrhundert hinein prägten. Unter den Franzosen, den Spaniern und später den Bourbonen verschärfte sich die Kluft zwischen den entwickelteren und besser gestellten Küstengebieten und der Berglandschaft. Die adeligen Besitzer der riesigen Berglandgüter wohnten in der Stadt und begnügten sich mit der Erhebung der Pachtgelder. Teil der typischen Landschaft des Inneren, der Madonie z.B., sind die masserie, Bauerngehöfte, die nunmehr zum architektonischen Kulturgut Siziliens gehören. Die isolierte masseria mit ihrem großen Eingangstor, ihren Haupt- und Nebengebäuden, Lagerräumen und dem geräumigen Innenhof war das sichtbare Zeichen einer zentralen Kontrolle der landwirtschaftlichen Produktion, die durch Tagelöhnerarbeit erfolgte.
Die höheren Bergregionen blieben menschenleer. Die Viehzucht war mit einem periodischen Wanderungssystem vom Berg Richtung Küste und umgekehrt verbunden. Selbst das interne Transport- und Verkehrssystem von einem Ende der Insel zum anderen wurde viel lieber über das Meer als auf dem Landweg betrieben. Nicht zuletzt war die Präsenz von organisierten Räuberbanden ein Grund der Isolierung der Berggebiete. Die Berge wurden weiter als menschenfeindlich empfunden, als wildes und gefährliches Gelände. In der Phantasie des Volkes waren sie von Dämonen, Tiermenschen, Hexern, Geistern behaust. Die sizilianische Literatur stellt eine faszinierende, aber den Menschen feindlich gesinnte Natur dar. Verga, Pirandello, Tomasi di Lampedusa beschreiben die Landschaft des Landesinneren als malerisch, aber stets mit pessimistischen Untertönen. Erdbeben, Erdrutsche, Eruptionen, Isolierung, Schnee und Kälte im Winter, Wassernot und Dürre im Sommer machten in der Tat das Leben der Bergleute nicht gerade leicht.
Der einzige als Freund betrachtete Berg war paradoxerweise der gefährlichste, der Ätna. Er wird von der lokalen Bevölkerung mit einer Mischung von Respekt und Dankbarkeit vertraulich und einfach im Dialekt als “a Muntagna” benannt. Die Einheimischen sind an das Zusammenleben mit dem aktiven Vulkan gewohnt. Im Gegensatz zu anderen Berggegenden Siziliens und trotz der vielen verwüstenden Lavaausbrüche ist die Einwohnerzahl im Gebiet um den Ätna ständig im Wachsen begriffen. Die außerordentliche Fruchtbarkeit der Erde machte diese Zone für eine intensive Bodenkultur geeignet. So entstand anstelle der ärmlichen Bewirtschaftung des Latifundiums durch die Tagelöhner eine blühende Agrarwirtschaft von kleinen und mittleren Ländereien, die noch dazu von der Nähe des Meeres und der Hafenstädte profitierte. Schon 1827 bemerkte Tocqueville, anläßlich seiner Sizilienreise, daß es für Adelige und Mönche zu viel Zeit, Mühe und Geld kostete, nach jedem Lavaausbruch ihre Grundbesitze wieder in Ordnung zu bringen; so blieben die Abhänge des Vulkans den Bauern überlassen, die mit harter und zäher Hackenarbeit die Lavakruste entfernten, um Anbauland zu gewinnen. Laut Leonardo Sciascia übernahm der Ätna die Rolle eines sozialen Reformers, d. h. er hat mit seinen Ausbrüchen die Fragmentierung des Großgrundbesitzes und die Entwicklung eines kleinen, florierendenen Eigenbetriebes im Familienrahmen begünstigt4. Diese rege landwirtschaftliche Tätigkeit hat in der Landschaft starke Spuren hinterlassen, z.B. die terrassierten Weinfelder und Obstgärten.
Der Ätna übt folglich eine positive Funktion aus. Er ist nicht mehr ein fürchterlicher, sagenumwobener Ort oder sogar Tor zur Hölle, wie die mittelalterliche katholische Publizistik beteuerte – wir dürfen nicht vergessen, daß um 1200 in Sizilien der laizistische Papstgegner Friedrich II. regierte und hier noch viel von der heidnischen Tradition und der arabischen Domination übrig geblieben war -, sondern eine Art Lebensgefährte, der den Menschen wohl Zerstörung, jedoch auch Nutzen bringt. In der Tat fehlt es nicht an Widersprüchen: er ist für ganz Ostsizilien ein Orientierungspunkt, läßt sich aber wegen seiner ständigen Ausbrüche auf keine bestimmte Höhe und Form festlegen; er spendet frische Höhenluft und Erholung für die umliegenden Ortschaften, verursacht jedoch bei jedem Ausbruch eine schwarze, alles bedeckende Aschenwolke; seine Lava bedeckt Wohnstätten und Anbaugebiete, ist aber zugleich regional ein vielverwendetes Baumaterial für Häuser und Straßen; von seinen Schneegipfeln fließen unterirdisch belebende Gewässer für die tiefer gelegenen Ortschaften, daneben auch zerstörende Feuerzungen. Schnee und Feuer, zwei sich kontrastierende Elemente, gehören untrennbar zu seiner Landschaft, die von der macchia mediterranea bis zur alpinen Vegetation wechselt, von üppigen Obstgärten und Wäldern bis zu den mit Asche und Lavageröll bedeckten, wüstenartigen sciare, d.h. Abhänge. Man unterscheidet 3 Zonen: die unterste bis 900 m Orangen- und Zitronengärten, Olivenhaine und Weingärten; zwischen 1.000 m und 2.000 m Obstbäume, Pistazienhaine, Kastanien, Haselnußsträucher, Nußbäume, Pinien, Birken, Buchen, Pappeln, Eichen, Ginster, Farnkraut; weiter oben findet man nur noch spärliche, niedrige Vegetation, Asche, kahle Felsen, Schnee und Eis5 .
Gerade mit den großen Reisenden und Künstlern des 18. und 19. Jahrhunderts, die auf der Suche nach malerischen Landschaften waren, begann hinsichtlich der Insel eine neue Phase der Kulturgeschichte. Wie in der Antike, wurden die Berge wiederum Gegenstand eines literarisch-künstlerischen Mythos. Sie wurden reichlich beschrieben, gezeichnet, gemalt. Die Wiederentdeckung des klassischen Altertums bedeutete ein erneutes Interesse für die griechisch-römischen kulturellen Zeugen, für archeologische Funde, für die von den Klassikern beschriebenen Szenarien. Die Berge Siziliens gehören also mit zum Mythos der “italienischen Reise”. Die eindrucksvollen Ansichten des schneebedeckten Ätna im Hintergrund des antiken Theaters in Taormina zogen schon seit dem 18. Jahrhundert Hunderte von Touristen an. Der Berg wird also zum Inbegriff, zur Ikone des beginnenden Reisefiebers, avanciert daneben gleichzeitig zum wissenschaftlichen Studienobjekt. Das naturwissenschaftliche und künstlerische Interesse für die Berge Siziliens erstreckte sich bald auf die lokalen Sitten und Bräuche, auf Dialekte und Lebensarten als Zeichen und Überreste einer archaischen Ära.
Mit der Vereinigung Italiens 1860 begann eine langsame Modernisierung der Berggebiete Siziliens, die jedoch noch nicht zur Abschaffung des Latifundiums führte. Getreideanbau und Viehzucht dominierten weiter. Waldprodukte wie Holz, Kastanien und Haselnüße wuden jedoch besser vermarktet. Auch handwerkliche und landwirtschaftliche Produkte (Weizen, Wein, Käse, Obst) erreichten neue Märkte. Zwar verschwand die bis Mitte des 19. Jahrhunderts blühende Seidenproduktion in den Monti Nebrodi, es blieb jedoch die Herstellung von Wollstoffen, Teppichen, Kunstkeramiken und Schmiedeeisenwaren6 .
Das 20. Jahrhundert ist durch eine steigende Entvölkerung der Bergzonen charakterisiert. Die massive Auswanderung der Sizilianer nach Amerika und später nach Nordeuropa oder Norditalien betraf vor allem die Bewohner des Inneren der Insel, die zum großen Teil aus Tagelöhnern bestand, und von der modernen Agrarwirtschaft ausgeschlossen worden waren. Erst nach dem 2. Weltkrieg wurden die Berge und Hochebenen zum Schauplatz einer tiefgreifenden ökonomischen und sozialen Veränderung, die letzten Endes auch die Landschaft der Berge und Bergstädte betraf. Die Bevölkerung der Madonie und Monti Nebrodi nahm an der Bauernbewegung teil, die zwischen dem Ende des 2. Weltkrieges und dem ersten Agrargesetz 1950 in ganz Süditalien stattfand. Die Besetzung der unbewirtschafteten Landgüter der alten Latifundien und Domänen, die Schaffung von Agrargenossenschaften erreichten nur z.T. die ersehnten Ziele, führten nach einer jahrhundertelangen Ausbeutung jedoch zur Verbreitung eines demokratischen Bewußtseins unter der Land- und Bergbevölkerung. Zum ersten Mal fühlte sie sich als aktiver Teil des Wiederaufbaues Italiens7 .
Das am 1. Mai 1947 stattgefundene Blutbad bei Portella della Ginestra, einer Hochebene in den Madonien, ist in der italienischen Geschichte und Kunst zum Symbol dieser Zeit geworden. Damals schoß die Bande des berühmten Banditen Salvatore Giuliano – im Sinne der Interessen der großen Landbesitzer und Viehzüchter, sowie der Gegner der Entstehung einer Bauernbewegung in Sizilien – auf friedliche Manifestanten, zum großen Teil Tagelöhner mit Frau und Kindern, die zusammengekommen waren, um den 1. Mai zu feiern und Brachland anzufordern. Diese tragische Episode bedeutete auch den Übergang von der damals auf dem Land existierende Mafia zur städtischen Mafia, die mit politischen und finanziellen Kreisen Interessensgemeinschaften bildete. Die Berggebiete waren im allgemeinen immer zu arm gewesen, um das Interesse der Mafia zu erwecken. In den Madonien und den Monti Nebrodi gab es jedoch zuweilen Mafia-Phänomene wie Viehraub, Schutzgeldforderungen, Gewaltakte im Auftrag der Großgrundbesitzer.
Heute kann die Beziehung zwischen Mensch und Berg auf Sizilien als ökologisch-touristisch bezeichnet werden. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurden der Ätna (1987), die Madonie (1989) und die Monti Nebrodi (1993) zu Naturparks erklärt. Die Entstehung von weiten Schutzgebieten hat die Entwicklung eines noch zögernden Agrotourismus begünstigt und eine Neubewertung der sizilianischen Bergbauernkultur bewirkt. Die naturalistischen, geologischen, kulturellen Besonderheiten der sizilianischen Bergwelt werden dadurch noch stärker hervorgehoben. Am Berg arbeitet man wissenschaftlich: man betreibt Fossilienforschung, archeologische Ausgrabungen, errichtet Beobachtungsstellen für vulkanische, tektonische, astronomische Phänomene; auf dem Ätna gibt es verschiedene Observatorien und Vermessungsstationen, und auf dem Monte Erice das international bekannte Zentrum für Kultur und Wissenschaft “Ettore Majorana”. Auch Botaniker und Zoologen entdecken in den Bergen Siziliens immer wieder neue, seltene Spezien.
In letzter Zeit wurde vor allem der Bergtourismus angekurbelt. Ganzjährig werden landschaftliche und kulturelle Wanderrouten angeboten. So besteht die Möglichkeit, spektakuläre Naturschauspiele kennenzulernen (Vulkanismus, tiefe Schluchten, Flußbette, die im Sommer austrocknen und im Winter zu reißenden Bächen werden), kulinarische Entdeckungen zu machen, alte Wohnstätten zu besichtigen, an folkloristischen Bräuchen und Festen teilzunehmen. Auch Wintersport wird mit Skipisten und Skilifts auf den Madonien und dem Ätna betrieben. Berg und Meer werden nicht mehr einander gegenübergestellt, sondern gepaart, indem man die Originalität und das Wachstumspotential einer Region betont, die sowohl aus Berg- als auch aus Küstenlandschaften besteht. Die naturfreundliche und anthropologisch-kulturelle Annäherung zur Bergwelt trägt sicher zu einer Verbesserung und einem Wiederaufleben der Agrarwirtschaft und des lokalen Kunsthandwerks bei. Die Frage ist jedoch, wie weit sich das traditionelle Verhältnis zwischen Berg und Mensch durch ständig anwachsenden Massentourismus verändert, ob das delikate Ökosystem der sizilianischen Bergwelt daneben durch Bauspekulation und Umweltverschmutzung gefährdet wird.
Anmerkungen
1 Über die Mythen um den Ätna vgl. Salvatore Agati: L’Etna e l’uomo, in Salvatore Agati (Hrsg.): Etna. Il vulcano e l’uomo, Catania, 1993, S.269-281 und Vincenzo Pappalardo, Santi e demoni dell’Etna, in S.Agati, a.a.O, S.283-297.
2 Diese und weitere Legenden sind unter folgender Internet-Adresse eines Bergführerunternehmens zu lesen http://www.escursioni.supereva.it
3 Einen Überblick über die Geschichte der Landwirtschaft in den Regionen des Ätna, der Peloritani und der Nebrodi bietet Sebastiano Maggio: Un’area metropolitana di equilibrio nella Sicilia nord-orientale ionica in Giuseppe Amata: Riposto e l’Alcantara: un porto per lo sviluppo dell’Etna, dei Peloritani e dei Nebrodi, Catania, 1995, S.119-206. Vgl. auch Michele Spadaro, I Nebrodi nel mito e nella storia, Messina, 1993.
4 Leonardo Sciascia, Cruciverba, Torino, 1983, S.294-298.
5 Für einen Gesamtüberblick über Landschaft, Geschichte, Wirtschaft, Traditionen, Literatur um den Ätna vgl. die Sammelbände Etna, mito d’Europa , Catania, 1997 und Salvatore Agati (Hrsg.): Etna. Il vulcano e l’uomo, Catania, 1993. Einige Informationen sind auch im Internet zu finden: http://mysite.ciaoweb.it/gorlan/etna/
6 Vgl. Sergio Di Giacomo: L’economia dei Nebrodi nella seconda metà del XIX secolo, in Salvatore Bottari (Hrsg.): Problemi e aspetti di storia dei Nebrodi, Marina di Patti, 1999, S.159-179.
7 Vgl. Maria Teresa Di Paola: Questione agraria e lotte contadine nei Nebrodi. La ricerca di una memoria, in Salvatore Bottari: Problemi e aspetti di storia dei Nebrodi, Marina di Patti, 1999, S. 229-250.