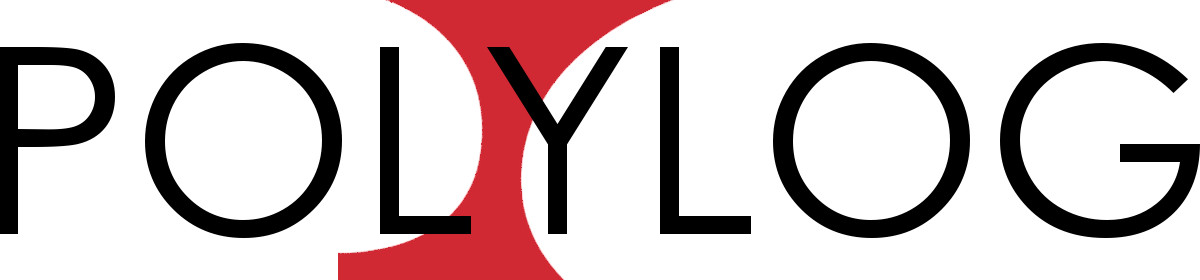Von András F. Balogh (Budapest)
Es ist schwer über die Berge in Ungarn zu sprechen, denn bekanntlicher- und realerweise ist Ungarn ein Flachland, dessen höchster Gipfel „Kékestetô“ (Blaues Dach) in eine Höhe von 1015 m ragt, der in gebirgigeren Ländern nicht einmal den Namen „Hügel“ oder „Anhöhe“ verdienen würde. Dennoch zeigen die Berge in Ungarn Präsenz: nicht in der geographischen Realität, sondern in der fiktionalen Welt der Literatur, nicht in ihrer physischen Gegenwart, sondern in der Symbolwelt der ungarischen Kultur sowie in der Denkweise der Menschen. Die Bedeutung der Berge im Pußtaland darf nicht unterschätzt werden, sie bedeuteten immer etwas Wichtiges, etwas, was die Menschen in Ungarn bewegt hat. Heute – wenn man sich einen Rückblick auf mehrere Jahrhunderte ungarischer Kultur leistet – läßt sich feststellen, daß die Berge ihren Weg in die Kultur leicht gefunden haben.
Das 18. Jahrhundert entdeckte für sich die Alpen und führte sie in die deutsche Literatur ein: Diese Entdeckung wurde dann in der Periode der Romantik noch weiter verstärkt, die Bilder aus dem Leben in den Bergen boten eine Schatzkammer für die Dichtung, die diese recht gut nutzen konnte. Diese Bilder, Ideen und Landschaftsschilderungen katalysierten ihrerseits die Entwicklung der ungarischen Literatur, die sehr schnell diese Entwicklung wahrnahm und die Bilder der bzw. den Blick auf die Berge sogar in die ungarische Nationalhymne einführte: „Öseinket felhozád Kárpátok szent bércére“ – „Gott, du führtest unsere Ahnen auf die heiligen Gipfel der Karpaten“ (Ferenc Kölcsey, Hymnus aus den trüben Zeiten). Trotz dieser frühen Verwendung des Blickes auf die Berge am Anfang des 19. Jahrhunderts in einer berühmten Stelle sah man sich in der ungarischen Literatur doch vor ein Problem gestellt: Wie kann diese Literatur die Faszination der Natur vermitteln, wie kann sie über das Lebensgefühl der Stille, der Sitte etc. sprechen, wenn in Ungarn keine Bildspender wie die Alpen vorhanden sind? Die Antwort wurde rasch gefunden: Die Pußta vermochte die gleiche Stimmung, die gleiche Romantik, das gleiche Lebensgefühl zu vermitteln, wenn man sie literarisch auszubauen wußte. Die ungarischen Dichter der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen in ihren Bestrebungen so weit, daß sie die Berge trotz der ungarischen Nationalhymne beinahe aus der Kultur ausgeklammert hätten. Den extremsten Fall stellt der – übrigens in einer Pußtalandschaft aufgewachsene – Sándor Petôfi dar, als er in einem Gedicht lautstark meinte, er bräuchte die Karpaten gar nicht, ihm genüge die Pußta, die sowieso alle Schönheiten des menschlichen Lebens zu bieten habe. Diese Meinung herrschte lange bei ihm und bei vielen seiner Zeitgenossen vor. Allerdings ist hier anzumerken, daß Petôfi diese Meinung in seiner letzten Lebensphase schließlich doch noch änderte: Als er die Gebirgslandschaft in Siebenbürgen während des Freiheitskampfes gegen die Habsburger 1848/49 kennenlernte, äußerte er sich in der Euphorie der Revalvation positiv über die Karpaten. Die Entdeckung neuer Naturschönheiten konnte aber nicht in allen Details in seine Dichtung eingehen, denn er starb kurz darauf im Alter von 26 Jahren im Kampf gegen die Habsburger auf dem Schlachtfeld.
Ungarn ging als Pußtaland in das europäische Kulturbewußtsein ein. Bei der Verbreitung dieses Topos spielten aber weniger die ungarischen Dichter als vielmehr die deutschen Dichter aus Ungarn eine Rolle. Lenau soll hier vermerkt werden sowie die sogenannten ungarndeutschen Dichter. Trotz der Nationalhymne, die eigentlich nur eine einmalige Belegstelle darstellt, herrschte die Pußta-Topik in Ungarn vor. Als Nachzug entwickelte sich auch die Bergsymbolik: Bei dieser Entwicklung spürt man ganz eindeutig die Impulse aus der deutschen Kultur. Im Klartext schrieb Samuel Bredeczky in der Vorrede zur ersten Ausgabe der Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern:
Warum, dacht´ ich oft, diese Sehnsucht nach der Schweiz und nach Italien? könnte sie nicht in der Nähe befriedigt werden? gleichen unsere Karpathen nicht den Schweizer Alpen, einige unserer Gegenden nicht denen des milden Hesperiens? oder hat dieses noch niemand mit Nachdruck gesagt?
Ich suchte und las nun das Meiste, was über unser Riesengebirge und andere Gegenden ist geschrieben worden, und fand bald, daß es nicht anders seyn könne.
Wenn ich die Schweizer Alpen besteige, in welche Welten fühle ich mich nicht versetzt! Hohe Geister umschweben mich; hier ergreift mich Hallers Muse, und erhebt mich über diese Felsen zu den Sternen; da zaubert mich ein anderer Genius in die unterirdischen Gemächer der Erde, ich sehe schauderhafte Gestalten, die meine Phantasie in Ehrfurcht gebietender Majestät vorüberziehn; dort gesellt sich der lieblich schwärmende Matthisson an meine Seite, und geleitet mich die schroffen Felsen hinauf, mir ists, als hörte ich die Zaubertöne seiner harmonischen Leyer aus der Kluft mir entgegen hallen…
Öde und todt ists dagegen um mich her, wenn ich die Karpathen erklimme. Zwischen den Gemsen, Steinböcken und Murmeltieren treten einzelne dürftige Gestalten einher, die, weil sie so alltäglich sind, weder meinen Verstand, noch mein Herz an sich ziehen können. Dort geht ein gesetzter Mann an das Krummholz, ängstlich beschäftigt, das Öhl aus demselben zu pressen; hier krebselt ein dürftiger Studente ohne Bildung die Felsen hinauf, und wundert sich über Dinge, die uns sehr bekannt sind etc.
Sollten dacht´ ich mir, kleine, mit Geist und Geschmack abgefaßte Beschreibungen einzelner Gegenden unsers Vaterlandes nicht das Interesse für dieselben erhöhen können? Wir haben freylich keine Haller und Matthissone; aber etwas besseres, besonders dem Geiste unseres Zeitalters mehr angemessenes, als der brave Buchholz und der joviale Simplicissimus könnten wir doch liefern.
Eine gebildete Seele muß die ganze Welt, vorzüglich aber das Vaterland interessiren.“ (Samuel Bredeczky, Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern. Budapest: 1802.)
Auf diese Weise vollzog sich der Eintritt der Berge in die Literatur. Gleich bei diesem Eintritt wuchsen die Berge zu bedeutungsgeladenen Topoi empor: Sie stellten die Heimat gegenüber dem Ausland dar. Eine gewisse Abgrenzung wird hier sichtbar; die Berge stehen gleichzeitig für eine Kulturlandschaft und für Literatur, auch Musik wird mit ihnen assoziiert. Als Summa dieser Assoziationskette stiegen die Berge zu Geboten auf, sie rufen zur Kultivierung des Landes, zur Kulturpflege und zur Weiterführung der Traditionen auf. Und schließlich bedeuten sie auch Vorurteile, wie es bei Norbert Purkhart, einem deutschsprachigen Autor aus Budapest zu sehen ist, der sich trotz aller positiven Konnotationen nicht scheut, fast abergläubische Ideen zu verlautbaren:
Mit immer wachsendem Herzklopfen näherte ich mich der Marmoroscher Erde, diesem letzten nordöstlichen Winkel Ungerns. Sie wissen Freund, welchen Begrif man bei uns davon hat. Er ist jenem nicht sehr unähnlich, den sich die Franzosen von Rußland machen. Auch dieses Ländchen (die Marmorosch) denkt man sich in der Entfernung bis auf die Kirchthurmknöpfe immer beschneit, und die Bären mit den Menschen in geselliger Conversation lebend. So wenig ich auch sonst auf dergleichen Gerede zu achten pflege, so muß ich doch bekennen, daß ich, je weiter ich fuhr, für diesen Glauben empfänglicher wurde, und wenigstens schon die Hälfte der Beschreibung als wahrscheinlich annahm.
(Norbert Purkhart: Über die Marmarosch. In: Ungrische Miscellen 1807, H. 3, S. 37-47., abgefasst 1801.)
In den Bergen leben die Menschen sicherlich nicht im größten Einvernehmen mit den Bären und die Landschaft ist auch nicht so öde, wie das von Purkhart halbherzig angenommen wurde. Das Gerede, die Unterstellungen und schließlich das Gespräch über die Berge führte letztendlich dazu, daß die Karpaten für die ungarische Literatur, aber auch für die deutschsprachige Literatur Ungarns, erstmals zu einem Schauplatz, schließlich aber zu einem symbolstarken Topoi geworden sind.
Die Romantik bzw. die ungarische Klassik haben die Berge zu ihrer wichtigsten literarischen Landschaft auserkoren. Die zeitliche Einordnung dieser Periode liegt zwischen 1830 und 1870/80. Der erste moderne ungarische Roman – ein romantischer Roman im Stil von Dumas und Scott – geschrieben von Miklós Jósika verlegt die spannungsgeladeneren Episoden in die Karpaten Siebenbürgens: Der Hauptdarsteller Abafi des gleichnamigen Romans kämpft für Gerechtigkeit. Die Berge gewähren Schutz, der ihm zum Sieg verhielft. Dieses Sujet kann in gleicher Form bei manchen Romanen von Mór Jókai, dem klassischen Romancier par excellence der ungarischen Literatur, wiedergefunden werden.
Daß den Bergen eine gewisse Schutzfunktion zugesprochen wird, findet sich nicht nur in der ungarischen Literatur. Der siebenbürgisch-deutsche Dichter – man entfernt sich hiermit vom Kulturraum der Karpaten nicht -, Martin Malmer (1823-1893), ein Zeitgenosse der genannten ungarischen Autoren, erinnert sich an die schönen Zeiten Siebenbürgens, als die Siebenbürger Deutschen ihre Unabhängigkeit gegenüber den Türken noch behaupten konnten – mit Hilfe der Berge:
Georg Hecht
An Hermannstadt vorüber – sie haben keine Lust
Den Hecht im Teich zu grüßen, der Brodfeldschlacht bewußt –
Ziehn sie mit reicher Beute mit Roß und Schaf und Rind
In Sklavenbanden treibend viel Männer, Weib und Kind.Schon sind sie in dem Engpaß und sehen sorgenlos
Des Stromes tiefe Stellen, der Felsen junges Moos.
Da schmettert aus den Bergen ein wohlbekanntes Horn.
Das ist der Hecht ihr Türken! Er kommt in grimmem Zorn.„Wohl dacht‘ ich mirs ihr Räuber, daß ihr mich nicht besucht;
Drum will ich euch empfangen in dieser Waldesschlucht.
Ihr ungezognen Gäste! Laßt sehn, was führt ihr aus!
Ist’s Sitte so zu plündern des Wirtes Hof und Haus?“(Martin Malmer: Georg Hecht)
Durch die Alpendiskussion animiert, zogen die Berge im Gegenzug zu den Pußtabildern in die ungarische Literatur ein. Allmählich konnten sich Anschauungen der Berge von den schweren Vorurteilen loslösen, und sie stiegen zu einem moralischen Imperativ auf, bzw. sie bewirkten eine positive Voreingenommenheit der Literaten. Auf diese Weise gingen die Berge in die ungarische Literatur der Moderne ein.
Die Moderne bedeutete in dieser Hinsicht auch einen Umbruch. Einerseits wurden die von der Romantik aufgebauten Bilder zurückgedrängt und zugleich für altmodisch gebrandmarkt, wonach sie keine wesentlichen Inhalte mehr zu vermitteln wußten. Wenn sie überhaupt noch verwendet wurden, dann erschienen sie als Bildspender besonderer Brisanz, wie im Liebesgedicht Wie der Schnee auf dem Gipfel des Montblanc von Mihály Vajda, einem Vorläufer der Moderne. Der kalte Schnee glüht im Lichte der untergehenden Sonne, genauso wie das Herz des Dichters, das nach sechzig Jahren immer noch die gleiche Leidenschaft in sich trägt, deren Intensität nichts eingebüßt hat. Diese Liebe wird selbstverständlich nicht erwidert, so ist die Innigkeit des Gefühls mit besonderer Stärke poetisch dargestellt. Das Bild des Montblancs läßt die Liebe des Dichters ins Unermessliche steigen: schade, daß keine gute deutsche Übersetzung von dieser Spitzenleistung ungarischer Poesie vorliegt.
Die bedeutendsten Dichter der ungarischen Moderne, Endre Ady, Mihály Babits, Zsigmond Móricz, Dezsô Kosztolányi gebrauchten weder die Bergsymbolik, noch ließen sie ihre Schauplätze – soweit solche überhaupt vorhanden – in die Berge verlagern. Die Erklärung ist ganz einfach: Die ungarische Literatur konzentrierte sich um die Jahrhundertwende immer stärker auf Budapest, das zwar einige Hügel aufzuweisen hat, die jedoch zur Jahrhundertwende die Menschen weder geistig, noch finanziell motivierten (heute ist das ganz anders, diese Hügel sind zum Jagdterraine der Grundstückspekulanten geworden). Zur Jahrhundertwende beziehungsweise bis zum 2. Weltkrieg war Budapest als Hauptstadt eines Flachlandes rezipiert und verstanden worden. Die Änderung wurde durch einen politischen Faktor hervorgerufen, und zwar durch das Friedensdiktat von Trianon nach dem ersten Weltkrieg, bei dem Ungarn 2/3 seines Hoheitsgebietes verlor – unter anderem auch die Berglandschaften. Damit gerieten die Berge wieder in die Symbolwelt ungarischer Kultur, wobei der kulturelle und der politsche Kontext nicht zu überhören war. Die Inhalte waren gegenüber der Romantik des 19. Jahrhunderts völlig neu, außerdem waren sie anders in der „binnenungarischen“ Literatur als in der neu entstandenen ungarischen „Auslandsliteratur“.
Eine Erklärung hierzu ist ganz einfach zu liefern: durch die Neuordnung der politischen Grenzen nach dem ersten Weltkrieg entstand eine ungarische Minderheit von beinahe 2 Millionen Menschen in Siebenbürgen, die nach geistigen Inhalten und Symbolen suchten, um sich ihre eigene kulturelle Legitimation zu schaffen. Den Bergen sprach man eine Schlüsselrolle in dieser geistigen Suche zu, sie sind zu Grundsatzsymbole geworden. Die Ungarn aus Siebenbürgen verstanden sich nämlich als ein Volk in einem Land umringt von Bergen, das von den politischen Mächten in Budapest und Bukarest manipuliert wurde, indem die mehrsprachige Bevölkerung gegeneinander ausgespielt wurde. Die Berge aber bieten den Menschen Schutz: Sie bedeuten die Ewigkeit, eine ewige Gerechtigkeit und feste Werte im bewegten und von der unberechenbaren Politik beeinflußten Leben. Nur aus der ungarischen Perspektive kann man diese geistige Suche verstehen, denn durch die neue Grenzziehung ist ein Reich von Tausend Jahren zugrundegegangen und damit sämtliche Ideale und feste Werte der Menschen. Dieses tausendjährige Reich war zwar ein Scheinreich, aber die Menschen haben seine politische Unhaltbarkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen, wie das im leicht revisionischtischen Roman von Albert Wass Adjátok vissza a hegyeimet (Gibt mir meine Berge zurück) zum Vorschein kommt. Man sah sich gezwungen, das eigene Dasein, die Sünden der Vorfahren und das Recht auf ein autonomes politisches Leben neu zu durchdenken. Die Dichter haben es noch schwieriger gehabt, weil sie all diese Probleme auch ins Ästhetische zu transponieren hatten.
Lajos Áprily gehört zu den bedeutendsten Dichter Siebenbürgens, der zum Schaffen neuer Symbole beitrug. In dem Gedicht A tetôn (Auf dem Gipfel) blickt das lyrische Ich in das Tal hinab, wo die personifizierte Geschichte ihr Unwesen treibt. Oben auf dem Berg herrscht aber Ruhe und Sanftmut, die auf die Menschen – unabhängig von ihrer Nationalität – einwirkt. Das harte Leben in den Bergen bietet allen Frieden und seelische Ruhe, man braucht nur die Berge gewählt zu haben, statt unten im Tal dubiosen Geschäften nachzugehen. Die Berge bzw. das Leben werden idealisiert, ohne daß dieses Idealisieren zu einer naiven Darstellung geworden wäre. Sie ist vielmehr Sehnsucht nach Harmonie, nach gesellschaftlichem Ausgleich, nach menschlichem Verständnis und nicht zuletzt nach Schönheit. Diese Schönheit der Berge wird zum Hauptargument in einem anderen literarischen Werk, im Roman Varjú nemzetség (Das Geschlecht der Raaben) von Károly Kós. Der jüngere Hauptdarsteller hat zwischen zwei Gehöften zu wählen, die er erben kann: Er wählt das Gehöft in den Bergen, weil ihm dort das Leben viel mehr Schönheit beschert als der Hof in der Ebene.
Dieses Idealisieren und Aufwerten der Berge – im Zeichen eines interkulturellen Herangehens – war nicht nur der ungarischen Kultur eigen. Es kann auch in der siebenbürgisch-deutschen Literatur gefunden werden. Der Zeitgenosse von Lajos Áprily, der ebenfalls Kronstädter (heute Brasov, Rumänien) Dichter war, der bekannteste Klassiker des Siebenbürger Deutschen, Adolf Meschendörfer (1877-1963), stilisiert die Berge seiner engeren Heimat, die Burzenlander Berge um Krinstad im Rilkeschen Stil hoch. Die Berge werden hier zum Inbegriff der Schönheit:
Ihr meerentstiegenen steinernen Tiere,
im Morgenhimmel silbern aufgebaut,
Wie ruht ihr fern und abgeschieden
und doch so heimattreu und heimattraut!
Ihr ruht bereift und duldet schweigend
der Zeiten Last: Stier, Hirsch und Kuh.
Verstummt und taub seit hunderttausend Jahren.
Nur Gottes Wind weht immerzu.
Sein Finger griff in die seufzenden Rippen,
er hat euch die zornigen Wampen gewellt.
Er löschte euch sanft die kristallenen Augen
und hat euch dennoch zu Hütern bestellt.
Das plumpe Gehörn, gezackte Geweihe
sank tief ins grämliche Firneneis.
In den zerschundenen Leibern nistet
Wacholder und blasses Edelweiß.
Ihr Meeresriesen, ihr steinernen Tiere,
im Abendhimmel zaubrisch aufgebaut,
Wie seid ihr nah und fromm und gut, ihr Lieben,
und heimattreu und heimattraut.(Adolf Meschendörfer: Burzenländer Berge)
Unproblematisch läßt sich hier der gleiche kulturelle Kontext und die gleiche Symbolwelt erkennen: Die Berge stehen fern dem Zeitgeschehen, dennoch bieten sie den Menschen geistigen Schutz, und sie werden zur Heimat der dort Beheimateten. Die Bergsymbolik entwickelte sich in den 30ern nicht mehr weiter: die Kulturen Siebenbürgens radikalisierten sich, der II. Weltkrieg implizierte neue Ausdrucksweisen und andere Symbole. Und wie steht es heute? Eine motivgeschichtliche Untersuchung brachte nur eine kleine Ausbeute: die Berge sowie die damit verbundene Problematik ist verschwunden, weil die politsche Brisanz des Themas nicht mehr da ist und die Bilderwelt der Romantik durch neue Ausdrucksmittel ersetzt wurde.