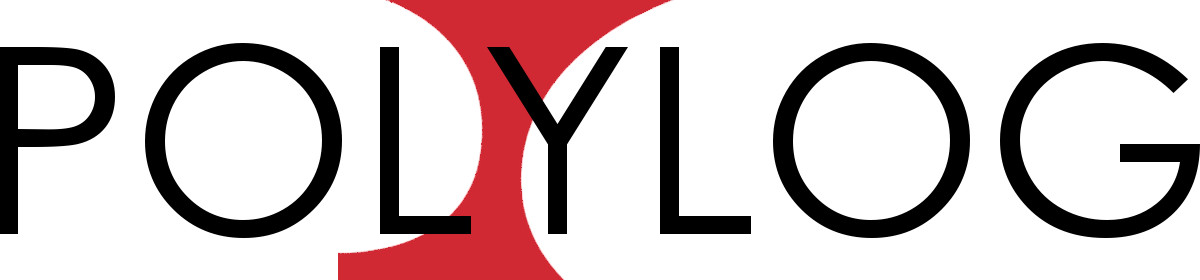von Surab Kiknadze (Staatliche Universität Tbilissi)
Hier wird es um die historisch formierten Gemeinden der gebirgigen Gegenden von Ostgeorgien, deren Struktur in Chewsurethi- und Pschawigemeinde (ihr ursprünglicher Name war Pchowi) bis heute auf ursprüngliche Art erhalten geblieben ist. Aber sie sind heute nun dabei, sich aufzulösen. Es gibt nur ganz wenige Angaben über sie.
Zum ersten Mal werden sie in der Zeit der Christianisierungseinführung erwähnt. Sie sind von unvorteilhafter Seite dargestellt: „Und (die heilige Nino) berief tierhafte Gebirgsleute aus Tschartali, Pchowi, Zilkeni und Gudamakari und ihnen wurde über den wahren Glauben von Christen gepredigt. […] Aber die Pchowi-Bewohner verließen ihr Land und zogen nach Tuschethi um.“ Also, nur die Pchower haben die Predigt der heiligen Nino nicht anerkannt und sind von ihren eigenen Wohngegenden umgesiedelt. Wie es scheint, hat der treueste Völkerteil des alten Glaubens es vorgezogen, seinen Ahnenbesitz zu verlassen als die Ahnenreligion zu verleugnen.
Zum zweiten Mal werden sie zur Zeit der Königin Thamari erwähnt. 1212 haben einige Bergstämme den königlichen Thron verraten. Unter ihnen werden Pchowi- und Didobewohner (ein Volk im Nordkaukasus) ausdrücklich hervorgehoben. Die Didoer sind folgendermaßen charakterisiert: „Die Didoer essen Leichen und Rohes. Mehrere Brüder heiraten eine Frau; sie sind Verehrer irgendeines unsichtbaren Teufels und einige eines schwarzen Hundes.“
Zum deutlichen Unterschied von Didoern wird über Pchower gesagt: „Pchower sind Diener des Kreuzes und bestehen darauf, Christen zu sein.“ Wie wir hier nun sehen, haben die Pchower ihren Glauben in neun Jahrhunderten vollkommen geändert. Vom Annalenschreiber werden sie nicht mehr als „tierhaft“ bezeichnet, aber er scheint wohl nicht endgültig im klaren über ihr Bekenntnis zu sein. Er zweifelt daran, ob die kreuzdienenden Pchower wahre Christen sind, für die sie sich nun halten. Der Dienst für das Kreuz (rituelle Seite) ist für den Chronisten keine ausreichende Bedingung dafür, Christ zu sein. Aber er gibt ihr Selbstbewusstsein ganz objektiv wider: „Sie bestehen darauf, Christen zu sein“ bedeutet nicht anderes, als dass sie sich für richtige Christen zu halten. Genauso wie die Urchristen sich Anbeter der Kreuzreligion (crucis religiosi) nennen, wie das von Tertulian, bezeugt wird, ist das Kreuz auch genauso das bestimmende Merkmal des christlichen Selbstbewusstseins der Pchower bereits von der Genesis an für ihre Gemeinde geworden (und so ist es auch heute). Als das Kreuz wurden alle Heiligen und Engelwesen (der heilige Georg, Erzengel Michael, Gabriel u.a.) genant, die von der religiösen Gemeinde gegründet worden sind und die zur gleichen Zeit Vermittler (Fürbitter) zwischen der Gemeinde und Gott geworden sind.
Zum dritten Mal werden sie in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erwähnt: Von der königlichen Macht ist den Pchowern ein Tribut auferlegt worden und die Menschen tierischer Natur sind als Maultierhirten bestimmt worden. (Chronist, s. Leben von Karthli I, 230, 5). Vom Chronisten dieser Zeit werden die Pchower doch wieder nach den alten Ansichten charakterisiert. Man kann also annehmen, dass im Unterschied zum Chronisten der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts der Autor dieser Worte Pchower selbst gar nicht gesehen hat. Es ist unglaubwürdig, dass sie sich innerhalb einer so kurzen Zeit so degradiert haben und zu einem „tierhaftern Angesicht“ zurückgekehrt sind.
Zum vierten Mal werden die Pchower – diesmal allerdings schon differenziert – als Chewsuren und Pschawer in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erwähnt. Die volkstümliche Dichtung hat die Kämpfe dieser Gemeinden (Stämme, Dienergemeinden) für ihre Unabhängigkeit mit Surab Eristhawi (wurde 1629 getötet) aufbewahrt. Der Versuch des den König abschwörenden hochmütigen Feudalen, den Besitz der Königlichen Domänen zu ergreifen, konnte als die Prätention auf das Königtum verstanden werden. Man kann annehmen, dass die Konsolidation der Pschaw-Chawsuren erfolgte. Durch die Volksdichtung werden sie uns als treue und opferbereite Diener ihrer Anbetungsobjekte -der Dshwari (Kreuze) – dargestellt. Zu dieser Zeit war die sakrale Gemeinde wahrscheinlich bereits formiert sein.
Zum fünften Mal werden sie in Wachuschti Batonischwilis „Beschreibung“ (1746) erwähnt. Da wird über die Pschawer gesagt: „Und haben sie den georgischen Glauben und die georgische Sprache, aber sie glauben an ihren Offenbarungskünder, der gleich einem Widersinnigen und Verrücktem plötzlich aufsteht und im Namen des heiligen Georg viel spricht und verkündet und daran, was er sagt, glaubt man und hält es für die pure Wahrheit.“ Von demselben Autor wird berichtet: „Jetzt werden sie allerdings Pschaw-Chewsuren genannt, die ursprünglich Pchover genannt wurden […]“ Auch hier sind die Pschawer, Nachkommen von Pchowen – aufgrund ihres religiösen Merkmals charakterisiert.
Was sehen wir hier? Die Nachricht von Wachuschti ist konkret. Sie entspricht ihrem religiösen Stand vollkommen, wie er bis in die letzte Zeit gelangt ist. Hier wird das Institut des Offenbarungskünders zum ersten Mal bestätigt, und auch der Kult des heiligen Georg.
Zum sechsten Mal werden sie während der Zeit von Erekle Batonischwili (1755) erwähnt. Der Königssohn Erekle, der zukünftige König von Karthl-Kachethi, tauft 40 Kinder der Chewsuren zum Zeichen der Versöhnung der Chewsurethigemeinde, was aber auch als der offiziellen Ausdruck der Wiederherstellung der Herrschaft über sie gelten soll. Durch diese Handlung, die auch ein politisches Moment enthält, verwirklicht Erekle das Recht von Bagrationi, durch welches die Bagrationi traditionsgemäß in den Stand der Pschaw-Chewsurethischen Anbetungsobjekte (Dshwari-Kreuze) aufgenommen wurden. Das Gudani-Dshwari in Chewsurethi und das Laschari- Dshwari in Pschawi werden als Mitbilder von Bagrationi in juristischen Unterlagen erwähnt. Die Dshwari-Diener sind Diener von Bagrationi und von weltlichen Vertretern der Gottessöhne. Einen anderen Herren haben die Pschaw-Chewsurethi-Gemeinden nicht gehabt. Diese Region – als ein Königsdomäne – war ohne Herrn über sich. Den Taufakt können wir als den Versuch zur Verstärkung des Christentums in den Chewsurethi-Gemeinden werten. Von jetzt an sind sie persönliche Diener von Erekle, als einem Mitbruder ihres Schutzheiligen.
Zum siebten Mal werden sie Ende des 18. Jahrhunderts erwähnt. Es ist das demographische Rechnungsbuch von Georgien (Karthl-Kachethi), das 1770 erstellt wurde und das der Hof von Erekle II. dem russischen Residenten vorstellt. Da liest man: „Es gibt Chewsurethi, halbchristlich, wegen unseres Zeitmangels und des Zeitenwandels im Glauben heruntergekommen. 1200 Bauernhöfe. Es gibt Pschawi, rechtgläubig christlich, 1000 Bauernhöfe. Es gibt Didoethi; von Lesgiern weggenommen in diesen 100 Jahren. 4000 Bauernhöfe.“ Diesmal wird der kulturelle und religiöse Aspekt von Didoethi-Bewohnern nicht angegeben, aber kennzeichnend ist ihre Erwähnung gemeinsam mit den Nachkommen der Pschawer. Diese Erwähnung steht im Einklang mit der obengenannten Nachricht aus dem 13.Jahrhundert. Wie man nun sieht, werden diese Gemeinden nach dem religiösen Merkmal charakterisiert.
Außer diesen Passagen gibt es keine weiteren Nachrichten in unseren Chroniken. Und die vorgefundenen sind widersprüchlich genug. In ein und derselben Zeit sind die Pchower sowohl „Dshwari-Diener“, als auch „tierischer Natur.“ Die Geschichte hat die Gemeinden ignoriert, die wegen der bösen Zeiten oder – wie es im Beschreibungsbuch geschrieben steht wird – „wegen unseres Zeitmangels und im Laufe der Zeit“ sich völlig vom Flachland Georgiens abwandten. Und sie hatten nach ihren Sitten und Bräuchen und nach ihrem Glauben und Bewusstsein zu leben begonnen, sich in Form des Kreuzes zum wahren Christentum bekannten.
In keiner einzigen Urschrift kann man (und es ist auch nicht zu erwarten, dass eine solche gefunden wird) eine Formierungsgeschichte vom ostgeorgischen Gebirge, sogar von Pchowi, der meisterwähnten Region, zu einer religiösen Gemeinde etwas lesen. Diese Randgebiete sind nie zum Gegenstand von besonderem Interesse für Annalenschreiber geworden. Darum wissen wir eben nicht, seit wann diese Gemeinden als solche sich diese Form angeeignet haben sollen, wie sie bis zum 19. Jahrhundert und teilweise bis zu unserer Zeit überliefert sind.
Mündliche Überlieferungen haben eine historische Vergangenheit aufbewahrt, die in drei Perioden betrachtet wird:
Die Formierungszeit des Soziums, der Kampf der Gottessöhne (engelhafter körperloser Wesen) und der Riesen endet mit dem Sieg der Gottessöhne und mit der Vertreibung der Riesen vom für die Menschen bestimmten Land, das die Riesen erobert gehabt hatten. Der Sohn Gottes wird zum Patron und zum Objekt der Anbetung.
Das Wichtigste, das in der Vergangenheit der Gemeinde existiert, und das ein Hauptthema der Überlieferungen des ostgeorgischen Gebirgslandes darstellt, ist die Gewinnung des Befreiers und dann des Wohngebietes von den von Riesen bedrängten hoffnungslosen Menschen oder anders gesagt: die Gründung einer religiösen Gemeinde. Der von den Riesen Befreiende wird zu ihrem Patron, der von der Vielheit der Menschen eine strukturelle Einheit – die Gemeinde – bildet und sie um ein Zentrum versammelt.
Der christliche Hintergrund dieser Sage ist nicht eindeutig. Obwohl es nicht schwierig sein soll, in der Entgegensetzung der Dshwari (Schutzheiligen) und Riesen die Entgegensetzung des Christentums und des Heidentums zu sehen.
Zum Erkennen des christlichen Substrats dürfte die epische Darstellung der religiösen Gegensätzlichkeiten kein Hindernis sein. Noch eindeutiger ist der christliche Ursprung von Dshwari-Diener in den Sagen, in denen die Gründung der Kreuzerscheinung mit den Ruinen der Wohnstätten der Mönche, die auf den als „heilige Berge“ genannten hohen Bergen erhalten geblieben waren, in Zusammenhang gebracht worden.
Nach den Sagen können in der „Geschichte“ der Dshwari drei Gradationszeiten abgesondert werden: 1. Die Zeit der Bergwunder, wenn die religiöse Wahrheit für alle sichtbar ist, die mit der Anfangszeit des Mönchtums und der Zeit der Kreuzerscheinung über die Feinde zusammenfällt; 2. Die Zeit der Höhle, wenn nun die Wahrheit sich vom Berg aus in die Tiefe zurückzieht und nur für Wenige erreichbar wird; in den diesen Zeitraum darstellenden Sagen wird von den mystischen Erlebnissen auserwählter Dshwari Diener erzählt; 3.Der Zeitraum, wenn es keine mystischen Erlebnisse mehr gibt. Wegen der Zeitbeschränkung kann in diesem Bericht keine Analogie nach dem analogischen Prozess der christlichen Kirchengeschichte gezeigt werden. Wir können unser Epoche als den vierten Zeitabschnitt betrachten, wenn die Krise den Höhepunkt erreicht hat. Wir sind Zeugen des Zerfalls der Dienergemeinde, als der Zerfallsperiode der religiösen Gemeinde.
Ein bestimmter historischer Zeitabschnitt, in dem die ostgeorgischen Gemeinden verwickelt waren und aus diesem Grund, allerdings nur zeitweilig erscheinend in der Chronik auftreten, scheint nur wichtig zu sein. Meiner Meinung nach haben die Kämpfe, in denen es um Leben und Tod ging, zur inneren Konsolidierung dieser Gemeinden geführt, und das ist in der Morphologie des Wortes sa k mo (Dienergemeinde) ganz deutlich zu sehen. Es ist die Zeit der Kämpfe mit dem Gegner des Königs, mit dem Feudalen Surab Eristhawi (1.Viertel des 17. Jahrhunderts). Sie müssen ihr von den Gottessöhnen für sie erschaffenes Land vor dem Feudalen, der durch die Eroberung dieses Landes nach der Eroberung der Königsdomänen strebt, schützen. Reales wird in mythologischer Hülle verschleiert. Als ob sie im Angesicht von Surabi und seines Heeres die aus der prähistorischen Epoche zurückgekehrten Riesen bekämpfen würden. Sie kämpfen im Namen der Gottessöhne. In mündlichen Überlieferungen – in dichterischen sowie in prosaischen Texten – sieht man, dass der Anführer der Dienergemeinde das Kreuz ist. Dieser Zeitraum erinnert uns typologisch an die Zeit der Richter aus der Geschichte Israels mit ihren theokratischen Merkmalen. Wegen des Mangels an Zeit können wir diese These hier nicht weiter erörtern. Die ostgeorgischen Dienergemeinden des 18. Jahrhunderts – und besonders die Pschaw-Chewsuren – kämpfen hartnäckig in den Kriegen des Königs. Dieser König ist Erekle II., für dessen eigene Diener (Untergebene) sie sich halten, indem sie ihren irdischen Patron mit dem unsichtbaren Patron zusammensehen, der für sie in der mythologischen Zeit den Wohnsitz erworben hat. Der König ist ein Mitbruder ihres Gebets- und Anbetungskreuzes, nämlich des Gudani- Dshwari-Giorgi; er berät sich mit ihm.
Wichtig ist nun das Problem des Territoriums, soviel er vom Dshwari gewonnen und in solchem Masse völlig heilig ist. Aber in diesem Heiligtum sind Orte zu unterscheiden, die als das Allerheiligste betrachtet werden sollen. Das sind die Orte, wo zum ersten Mal die Kreuze erschienen. Im religiösen Bewusstsein nehmen Vorstellungen über den heterogenen Raum einen großen Platz ein, was auch durch diese präzise und geschliffene Terminologie aufgezeigt wird.
Ähnlich dem Ideal Aristoteles‘ von der griechischen Polis reicht das Ansiedlungsgelände der Dienergemeinde so weit, wie es für das menschliche Auge sichtbar ist. Ihre Angehörigen erkennen und kennen sich persönlich. Der auf dem Hügel errichtete Glockenturm steht auf dem für den Blick aller Bewohner erreichbaren Ort und der Glockenschlag kann jeden erreichen. Durch den Glockenschlag werden sie nicht nur zur Versammlung zusammengerufen, damit die aus ihren Wohnhäusern Heraufgekommenen zu einer Ganzheit gemacht werden, sondern durch ihn wird ihr Ansiedlungsgelände auch akustisch umkreist. Der Überlieferung nach ertönt der Glockenschlag zum ersten Mal während der Genesis der Dienergemeinde in der Zeit ihrer Bildung, wie uns ein pschawisches Kultgedicht selbst durch das Dshwari bekannt gibt: Lasst mein Glöckchen für mich auf Awisgori (Name eines Hügels) aufhängen, sein Klang soll bis Achadi (eine Dienergemeinde in Pschawi) hinreichen, und da sollen sie sich bekreuzigen, damit meine Diener den Gottesdienst abhalten sollen.